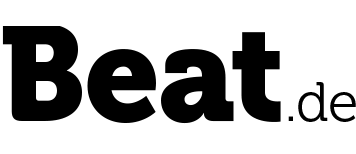Für sein neues Album ging Martin Stimming an die Extreme. Einen Monat lang zog er sich auf eine abgelegene Hütte zurück und begab sich anschließend auf ein Containerschiff. Dabei war er mehr als einmal dem Wahnsinn nahe. Doch entstand aus der Verzweiflung das wohl beste Werk seiner Karriere. Beat besuchte Stimming in seinem Hamburger Studio, um die Details zu erfahren.

Eine gute Geschichte kennt keinen Anfang und kein Ende und sie hört auch dort nicht auf, wo die Worte versagen, eine eigenständige Welt, für immer eingeschlossen in einer privaten, zeitlosen Realität. Vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass ich die Lichter der Stadt inzwischen hinter mir gelassen habe und die Dunkelheit Einzug in mein Abteil gehalten hat. Oder daran, dass es mir so vorkommt, als sei ich der einzige Reisende in diesem Zug von Hamburg nach Berlin. Doch wahrscheinlicher ist es wohl, dass ich heute so viele gute Geschichten gehört habe, dass es mir gar nicht seltsam vorkommt, dass ich aus dem Fenster blicke und ein Flimmern am äußersten Rand des Horizonts bemerke, einen feinen, rötlich-gelben Streifen vor einer schwarzen Leinwand, ein heißes Glühen wie von einer fernen Stahlschmelze.
Die Erscheinung ist bemerkenswert real – doch ist mir klar, dass es sich dabei nur um eine Erinnerung an mein Interview mit Martin Stimming handelt, der mir vor einigen Stunden über Einsamkeit und Isolation erzählt hat, darüber, dass sie nicht nur eine Form der Abwesenheit sind, sondern auch eine eigene Präsenz entfalten, dass sie dich von Grund auf verändern und die Welt mit anderen Augen sehen lassen. Er selbst spricht aus Erfahrung, ist für sein neues Album „Alpe Lusia“ auf den Spuren des Wahnsinns gewandert, hat sich in die Höhen der Dolomiten begeben und Stürmen getrotzt, sich eisigen Temperaturen gestellt und die schonungslose Auseinandersetzung mit der inneren Gefühlswelt gesucht. Zu guter Letzt war da noch diese Reise als einziger Passagier auf einem riesigen Containerschiff, bei der er zwei Wochen lang die Sicherheit festen Bodens unter den Füßen aufgab. Und irgendwann, in der Finsternis des frühen Morgens, taucht dann der Hafen von Rotterdam vor seinen halb geöffneten Augen auf – und es verschlägt ihm glatt den Atem.





Die Hölle glüht
„Da ist dieser glühende Streifen und du denkst zuerst, das ist die Hölle, die sich da auftut“, so Stimming, „Aber nein, es sind einfach nur Millionen von Containern“. Auf diesen Augenblick hat er hingefiebert, seit ihm ein Taxifahrer in Bremen vor der Abfahrt davon erzählt hat. Es hat etwas gedauert, bis er, mit einem Helm auf dem Kopf, das Selbstbewusstsein entwickelt hat, sich auf den kalten Metallflächen der „Helle Ritscher“ frei zu bewegen. Es ist das größte Schiff, das die Hamburger Sietas-Werft jemals gebaut hat, bevor sie nur zwei Jahre später in einem medienwirksamen Kollaps Insolvenz anmeldete. Jeden Tag hat er den Koloss ein wenig mehr erkundet, den Maschinenraum besucht, eine „Welt in der Welt“ mit lichtscheuen Bewohnern, in der er unter der Sicherheit von Kopfhörern das ohrenbetäubende Anfahren des 20.000-PS-Motors miterleben durfte, einem Bass-Sound, zu dem das Schiff über den endlosen Dancefloor des Ozeans über die Wellen tanzt. Man ist freundlich zu ihm und die gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten, militärisch pünktlich um 7 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 17 Uhr abends serviert, sind gut. Und dennoch, so Stimming, hatte er hier ganz eindeutig nichts zu suchen. Er ist ein Fremdkörper in einem lebenden Organismus, in dem es keine Ruhetage gibt und manche Crew-Mitglieder viele Monate am Stück arbeiten. Man trifft hier auf Charaktere, die an die knorrigen Figuren aus einem Joseph Conrad Roman anmuten, erlebt aus erster Hand „zwischenmenschliche Kammerstückdramen“. Weiter entfernt von den Bequemlichkeiten und beruhigenden Routinen der Zivilisation könnte man hier kaum sein. Und genau das ist es auch, was Stimming so dringend gesucht hat.
Denn die Reise mit der „Helle Ritscher“, eine zweiwöchige Tour, die ihn von Bremer Hafen nach Helsingborg, Göteborg, Rotterdam und wieder zurück bringen wird, ist kein Urlaub, sondern ganz der Vorbereitung auf seine anstehende Tour gewidmet. Musikalisch wird alles infrage gestellt. Auf einem Tisch in seiner Kajüte, die mit einer kleinen Dusche, einer gemütlichen Sitzecke und zwei Bullaugen mit Sicht auf die See recht angenehm eingerichtet ist, hat er seine Geräte ausgebreitet und brütet stundenlang über den Arrangements. Diese Anordnung hat nahezu nichts mehr gemein mit dem Ableton-basierten Setup seiner ersten Gigs, die vor allem auf einem Bedürfnis nach Stabilität beruhten. Diese Stabilität, so wird ihm nämlich zunehmend klar, möchte und muss er nun hinter sich lassen. Das Risiko ist dabei um ein Vielfaches größer als früher. Dafür sorgt allein schon die Tatsache, dass der Stop-Button auf dem Octatrack einen Zentimeter neben dem Play-Button liegt und er auf den Play-Button muss, um etwas einzuspielen. Vergreift er sich, ist die ganze Nummer gestoppt. Und daran, dass genau das passieren wird, zweifelt er keine Sekunde. Innerlich lacht er bei der Vorfreude an die Spannung, an die Herausforderung in einem solchen Notfall cool zu bleiben und einfach im richtigen Augenblick die Maschinerie wieder in Gang zu setzen. Doch ein wenig schlottern ihm auch die Knie. Denn dieses kompakte Setup mag zwar in einen recht kleinen Koffer passen, in dem sogar immer noch Platz für eine Zahnbürste und ein paar Hemden ist. Doch ist es bemerkenswert komplex. Das Herzstück bildet mit dem genannten Elektron Octatrack ein Gerät, welches die eher studiogebundene Kunst des Samplings mit der live-orientierten Direkbearbeitung aller relevanten Parameter verbindet, und es wird ergänzt um Sample-basierte Percussion-Tracks von der Drum Machine und verschiedenste weitere Bausteine. Das sich dabei ergebende Netzwerk ist weit mehr als nur ein tragbarer Gerätepark. Es fühlt sich, so Stimming, wie ein eigenständiges Instrument an.
Synthese aus dem Quantencomputer
Stimmings Hamburger Studio ist bereits in das Zwielicht des frühen Abends getaucht, als er mir das erzählt und ich lausche den Ausführungen zusammen mit Pete von Stimmings Label „Diynamic“, der unserem inzwischen über zwei Stunden langen Gespräch auf einer bequemen Couch aus geringer Entfernung aufmerksam zuhört, wie einer spannenden Seemans-Story. Doch geht es hier immer noch um Musik. Stimming denkt kurz nach und erklärt uns dann, warum ihm diese Nähe seines Setups zum Feeling eines akustischen Instruments so wichtig ist: „Ich würde sagen, es gibt Saitenleute, die die Saite direkt in der Hand halten wollen und Tastenleute, die eine Mechanik dazwischen haben. Ich will überhaupt keine Diskussion darüber aufmachen, was besser ist, aber was die beiden gemein haben, ist die wahnsinnige Ausdrucksstärke. Das ist das eigentliche Problem bei vielen elektronischen Geräten.“ Während er redet, lutscht Stimming, zur Unterstützung seiner Bemühungen mit dem Rauchen aufzuhören, an einem Lolli, während ich auf einem in alle Richtungen beweglichen lehnenlosen Hocker derart hin und her wackele, dass ich das Gefühl habe, ich befinde mich ebenfalls auf hoher See. „Was ist mit dem Roli Seaboard?“, frage ich aus einer ausnahmsweise halbwegs aufrechten Haltung. „Bei dem merkt man, das sind Leute, die das erkannt haben. Die gehen einen Schritt weiter und nehmen diesen dritten Parameter pro Taste mit dazu“, so Stimming, „Fühlt sich jetzt nicht so gut an, dieses Gummiding, in das man reingreifen muss, ist aber wahrscheinlich Gewöhnungssache. Doch selbst das verblasst gegenüber einer Snaredrum. Das kann man ja gar nicht aufzählen, wie viele verschiedene Varianten ein und desselben Tons da raus kommen. Da bräuchtest du für eine Synthese einen Quantencomputer.“ Er schnappt sich noch einen Lutscher und ich versuche mit voller Konzentration, schnell einen Schluck Kaffee zu nehmen, ohne gleich alles zu verschütten.





Von genau dieser Ausdrucksstärke, die auf ganz unmittelbare Weise ungeahnt tiefe emotionale Reaktionen auszulösen imstande ist, zeugt nicht nur die Anwesenheit eines direkt neben der Tür stehenden Pianos, das schon auf früheren Stimming-Produktionen immer wieder zum Einsatz kam sowie die für seinen so erkennbaren, schlurfig-verschleppten Schlagzeug-Sound verantwortlichen Shaker. Sondern vor allem das wundersame Stück „Tanz fuer Drei“, das sowohl für mich als auch Stimming selbst das Highlight auf „Alpe Lusia“ bildet, ein wie aus der Welt gefallener Song, in dem es keinen Bass gibt, dafür aber drei Elemente, die sich im Laufe von acht Minuten verzweifelt suchen und immer wieder in kurzen Augenblicken atemberaubender Schönheit finden: Eine stumpf pumpende Kickdrum aus dem Tanzbär, das besagte Klavier, das hier klingt wie die tongewordenen Tagebucheinträge eines liebeskranken Dichters sowie die urtümliche Wucht eines Harmoniums. Letzteres hat Stimming bei seinen Eltern in der Nähe von Gießen aufgenommen und das asthmatische Ächzen und Saugen in traumhaftem c-Moll ist genau von diesen unzähligen Nuancen und Zwischentönen geprägt, die er an akustischen Resonanzkörpern so schätzt: „Ich habe mich vor zwei Jahren mit einem Sony-Rekorder an das Harmonium gesetzt. Unter der Klaviatur hat dieses Instrument ein Schallausgangsloch, da habe ich den Rekorder direkt reingelegt, einen Akkord gegriffen und dann erst Luft rein. Deswegen hat das auch so einen „Wumm“. Und dann kommt noch zweimal eine todeskitschige Melodie und eine Akkordprogression, die total schön ist, ohne kitschig zu sein. Das ist so „lost“ und gehört trotzdem zusammen. Da bin ich froh, die Nummer noch durchgezogen zu haben.“ Freilich ist Stimming alles andere als ein musikalischer Nostalgiker oder gar ein Anhänger der aktuell so beliebten Retro-Bewegung. Für ihn ist an Musik so faszinierend, wie, einerseits, reine Gefühle in wenigen Sekunden zu etwas Technischem werden können und wie man, andererseits, über diese technischen Parameter direkt in die Seele des Hörers greifen und sie erneut mit Gefühlen füllen kann. Man könnte das Pathos des letzten Satzes als Ironie verstehen, doch daran, wie ihn Stimming sagt, merkt man, dass es ihm sehr ernst ist. Und diese Doppeldeutigkeit, diese Bedeutungsschwere in einer gelegentlich verspielt anmutenden Musik, macht ihn auch als Person immer noch aus.
Das wird mir bereits klar, als ich am frühen Mittag zusammen mit Pete sein Studio betrete und merke, wie begeistert er über unsere verdutzten Gesichter ist. Auf dem Hinweg vom Bahnhof hat Stimming uns am Handy erzählt, irgendwelche Jugendlichen hätten ihm faule Äpfel durch die Scheibe geschmissen und es rieche jetzt alles nach Most. Nun freut er sich diebisch darüber, dass wir ihm die Geschichte abgenommen und ihm auf den Leim gegangen sind. Doch schon kurz danach konzentrieren wir uns auf die uns umgebende, fast schon Zen-mäßige Leere des Studios. Gegenüber früher hat Stimming seine Arbeitsumgebung noch einmal radikal umgestaltet, sein Raumschiff-Cockpit gegen einen einfachen, massiven Tisch eingetauscht, auf dem kaum mehr als der von ihm so innig geliebte OP-1 von Teenage Engineering, ein Windows-Tablet (das als Zentrale funktioniert), eine modulare Lunchbox und ein Monitor stehen. Alles andere ist sauber aufgeräumt und im hinteren Bereich des Raums verstaut, wo es bei Bedarf sofort zur Verfügung steht. Kaum sind wir drin, beginnt schon eine spannende Ausführung über die Pros und Contras des neu gefundenen Spartanismus und warum er sich einiger Geräte entledigen wird, die noch bis vor Kurzem einen scheinbar essenziellen Bestandteil seiner Produktionen bildeten. Verschwunden ist beispielsweise die Sherman Filterbank, versteckt der Microbrute, den man von den Live-Gigs kannte. Eigentlich hätten diese extrem roh klingenden Instrumente niemals wirklich zu ihm gepasst. Zwar sei der dreckige Microbrute, den er wahlweise und laut lachend, halb ironisch, halb ernst, als „Scheiß-“ oder „Dreckskiste“ bezeichnet, das perfekte Gegenstück zu seinem ansonsten so klinischen Ableton-Live-Set gewesen. Doch sei genau dieses nach seiner Episode auf der „Helle Ritscher“ nun endgültig Geschichte.
Ruhiger Puls
Vom Fenster des Studios aus blickt man nicht nur auf die wenige Meter neben dem Gebäude verlaufende S-Bahn – „die versaut mir sehr leise Aufnahmen“ – sondern auch auf den acht Kilometer in der Ferne liegenden Fernsehturm, eine Distanz, die er jeden Tag mit dem Fahrrad zweimal zurücklegt. Dazwischen liegt eine Stadt, die zugleich Dorf und Metropole ist, die für einen weitaus wärmeren Sound steht als die Techno-Hochburg Berlin, für einen deutlich entspannteren Puls als sein früherer Bezugsrahmen Frankfurt. Stimming hat nur über Umwege diesen Puls angenommen – später spielt er mir minutenlang einen großartigen unveröffentlichten Track nach dem anderen vor, in denen fetter Eye-Q-Trance ebenso seine Aufwartung macht wie kommerzieller RnB, lässiger Downbeat und ein komplettes 2-Step-Album, das wohl für immer in der Schublade liegen wird – aber seine Liebe zu instrumentalem Hip-Hop hat den Prozess eindeutig begünstigt. Es ist eine Liebe, die man aus seiner Musik nicht sofort heraushört, die aber immer noch Bestand hat. Als Pete und ich vor dem Interview, bei einer Bäckerei in der Nähe des Studios in unserem Mini um die Ecke biegen, entdecke ich eine Litfaßsäule mit einem Poster für ein bereits vergangenes Konzert des Pioniers DJ Krush, dessen „Kakusei“ Stimming als Teenager schwer beeindruckt hat. Natürlich war er auf dem Gig, erzählt er mir bei unserer ersten Tasse Kaffee in der gemütlichen Küche des Studios mit Ausblick auf das Treiben der Straße unter uns, und es sei toll gewesen, wie dieser Mann mit der Coolness des Alters einen großartigeren Track nach dem anderen rausgehauen habe. Sogar heute schätzt er die dahinter stehende Attitüde des Nicht-Durchdrehens, bei der nicht alles gleich „groß und krass“ sein müsse und es reiche, „wenn das Ding cool ist“.





In Hamburg findet man genau diese Verbindung zwischen Hip-Hop und House immer wieder, von den melancholischen Stimmungsbildern eines Moomin bis hin zu den schillernden Loops eines Christopher Rau. Trotzdem gebe es aus seiner Sicht erstaunlich wenig Austausch zwischen den Musikern hier. Zu Zeiten seines frühen Projekts Gebrüder Ton habe es noch eine Verbindung zu Samuel Kindermann alias Einmusik gegeben, mit dem er gemeinsam das Label Modus Operandi leitete und einige legendäre Nächte in der völlig verrauchten, sauerstoffarmen Hütte des Pudel-Clubs erlebte. Ansonsten aber seien die Kontakte eher sporadisch. Gelegentlich treffe er DJ Koze, für den er gerade noch den ursprünglich für „Alpe Lusia“ bestimmten „Track #17“ zur Compilation „Pampa Vol. 1“ beisteuerte, die, wie wir beide finden, unfassbar gut geworden ist und auf der Hamburger Künstler wie Isolée, Ada, Lawrence und Acid Pauli eindeutig den Ton angeben. Auch die wunderschöne und ein wenig an „Tanz fuer Drei“ erinnernde EP „Southern Sun“ sei aus einer spontanen Begegnung mit Koze entstanden. Der nämlich war auf dem Weg zur Kampfsportschule gegenüber von Stimmings Studio und habe kurz vorbeigeschaut. Irgendwie sei anschließend dieses magische Stück Musik entstanden, das rückblickend fast wie ein Vorbote auf das neue Material anmutet.
Perfekte Abgeschiedenheit
Diesen warmen, organischen Stimming-Sound verdichtet und erweitert „Alpe Lusia“ und macht ihn zu der perfekten Reise, welche die vorangegangen drei Alben bereits andeuteten, ohne sie jemals vollends umzusetzen: Das emotional aufgeladene Debüt „Reflections“, auf dem der Künstler sein Inneres nach außen kehrte. Das sperrige Zweitlingswerk „Liquorice“, das aus einer Trennungsphase resultierte, in der Stimming lange im Studio schlafen musste, ein aus Wut geborenes „Punkwerk“, das hohe Kunst sein wollte, aber gemeinhin schmerzhaft verkannt wurde. Und das selbst benannte Vorgängerwerk mit seinem fein ausbalancierten Klang, auf dem alle Elemente bereits isoliert Anwendung finden, die auf „Alpe Lusia“ nun in einen faszinierenden erzählerischen Sog eingebettet werden. Man darf hier schon von einem großen Wurf sprechen, unter anderem auch deswegen, weil die Scheibe gerade im zweiten Teil durch orchestrale Elemente aufgewertet wird, von den Streichern auf „Saibot“, einem bereits acht Jahre alten Stück für einen von Schicksalschlägen geplagten Freund, bis hin zu den filmreifen Gesangslinien auf dem zentralen „22 Degree Halo“, die von einem Mexico-Trip inspiriert und von einem 24-köpfigen Chor für ihn in Riga aufgenommen wurden. Es ist Musik, die in ihrer inneren Verbundenheit nur dann entstehen kann, wenn man sich vollständig von allen Verpflichtungen zurückzieht und sich ihr mit Herz und Seele widmet. Tatsächlich hat Stimming das sogar zweimal getan. Ein erster Anlauf in einem Zeltdachhaus in der Ostseeretorten-Stadt Damp scheiterte gnadenlos, als die Stromkosten, um das nachts auf Minustemperaturen abgekühlte Haus wieder aufzuwärmen, das Budget zu sprengen drohten und der Funke in Stimmings kreativem Ofen einfach nicht überspringen wollte. Erst eine Bekannte in einem Reisebüro vermittelte ihm den idealen Ort: eine kleine Hütte in den Dolomiten, in der 70% des Albums entstanden – und in der er sich musikalisch seinen Dämonen stellte.





Die Szenerie war dafür wie geschaffen: Am traumhaften Passo Rolle, mit klarem Blick auf die majestätischen Bergketten des Südtiroler Rosengartens, stand seine Unterkunft in nahezu perfekter Abgeschiedenheit. Ab und an kam ein Schäfer vorbei und ungefähr 200 Meter weiter über ihm wohnte eine Einsiedlerin, die allerdings ausschließlich Italienisch sprach. Ansonsten nur: „Kühe, Kühe, Kühe“, denen folgerichtig in der stimmungsvollen Einleitung des Albums klanglich ein Denkmal gesetzt wurde. Und so waren die wenigen Worte, die Stimming alle zwei Tage mit den Gästen eines nahe gelegenen Gästehauses beim Essen wechselte, die einzigen Kontaktpunkte mit der Menschheit. Ansonsten wurde sein Rhythmus von der Arbeit an den Skizzen bestimmt, die er sich mit in die Berge genommen hatte und die er nun in langen, intensiven Sessions und in knapp zweieinhalb Tagen pro Track zu Ende brachte. Die Konzentration, Leidenschaft aber auch Gnadenlosigkeit dem eigenen Material gegenüber wurden in dieser ebenso märchenhaften wie rauen Landschaft auf die Spitze getrieben. So wurde ihm schon recht bald klar, dass einige der von ihm für viel Geld in Auftrag gegebenen Orchesteraufnahmen musikalisch schlicht nicht gut genug waren und ausgemustert werden mussten. Gegenüber früheren Alben waren die inneren Konflikte diesmal weniger vage, ohne aber zum reinen Spiegel zu werden. Vielmehr entstand ein Werk, auf dem man dem Künstler bei der Bewältigungsarbeit zuhören kann, das frei fließt, aber trotzdem minutiös komponiert wurde, in dem die Musik aus den Klängen der Tierwelt entsteigt, aus dem Wind, der um die Holzbalken heult, aus der endlosen Weite des Panoramas.
Immer wieder hört man auch den Kampf heraus, die Begegnungen mit dem Wahnsinn. Bei schlechtem Wetter verschwand der idyllische Blick auf die Berge und packte den nunmehr eingeschlossenen Musiker auf eine unerklärliche Weise. Die Dunkelheit und Härte auf dem mit einem Hurdygurdy eingespielten „Symphorine“ ist das direkte Ergebnis dieser Grenzerfahrungen: „Ich wusste, ich bin hier alleine, ich kann hier durchdrehen, wie ich will – und das bin ich auch. Und bei dem Stück habe ich dann nach zwei Tagen gemerkt, ich muss aufhören. Ich habe mich da in mentale Grenzbereiche begeben. Da hätte man mich nicht filmen dürfen. Das sah wahrscheinlich nach schlimmen Drogen aus.“ Es fällt nicht schwer nachzuvollziehen, dass die Inspiration zu dem Trip von einer Ausstellung zum berüchtigten „Unabomber“ Ted Kaczynski herrührte. Dafür hatten die Veranstalter ein originalgetreues Modell derjenigen Hütte in Lincoln, Montana in Auftrag gegeben, in der Kaczynski sich der Zivilisation zu entziehen versucht und in der er letztendlich auch den Verstand verloren hatte. Immer wieder kam Stimmings Vermieterin vorbei, um sich nach seinem Zustand zu erkundigen, konstatierte aber zunehmend: „Du bist sehr stark, Martin!“ Und der Erstarkende erkannte immer mehr, dass es trotz der in der Musik enthaltenen Hinweise und Sounds gar nicht so sehr die Umgebung war, die ihn zu dieser Musik bewegte, sondern vielmehr die Wirkung der plötzlich frei laufenden Zeit, die gänzlich ihre Bedeutung verlor und den Blick auf ein kleines bisschen Unendlichkeit freigab. Gerade auch deswegen ist „Alpe Lusia“ wohl im Stimming-Kosmos das am wenigsten verspielte Album geworden, vielmehr ein Werk in den Fußstapfen einer Tradition, als Teil derer sich Komponisten wie Gustav Mahler auf ihr Häuschen in den Bergen zurückzogen, um die nächste Symphonie zu schreiben – eine Tradition, die Stimming unbekannt war, die er aber mit der für ihn so wichtigen Intuition wohl erahnt hat.
Vielleicht ist es ja das, was dieser Scheibe ihre Magie gibt, denke ich, während der Zug in Berlin einfährt, und die Bilder von der Alp dem fernen Leuchten des Hauptbahnhofs weichen: Dass sie eine eindeutige emotionale Geschichte erzählt, auch wenn sich diese nicht so leicht auf den Punkt bringen lässt. Dass sie vielleicht auch gar keinen Punkt zu haben braucht, sondern dich einfach nur eintreten lässt und dann in eine Stimmung hineinzieht, die sich nicht in der Zeit, sondern ausschließlich in der Vorstellung ausdehnt. Für die Dauer der Musik ist sie deine ganze Realität und diese Realität kennt zwar keinen Anfang und kein Ende, aber sie beginnt doch genau dort, wo die Worte versagen. Und sie versagen genau hier.
2009 | Reflections
2011 | Liquorice
2013 | Stimming
2016 | Alpe Lusia