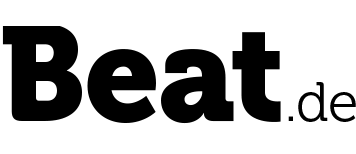Die Möglichkeiten beim Produzieren scheinen heute endlos, doch immer mehr Musiker verlieren sich ihn ihnen. Warum ist es so schwierig, das zu machen, was man wirklich will? Tobias Fischer findet eine Antwort darauf!

Santiago de Compostela, der Endpunkt des Jakobswegs, ist nicht nur ein idyllisches Örtchen. Es ist auch ein Symbol für Hoffnung. Jedes Jahr wandern Tausende von Pilgern den langen verschlungenen Pfad durch sengende Hitze und über steile Pässe, auf der Suche nach Antworten auf die vielleicht wichtigste Frage überhaupt: Was bedeutet mein Leben und was soll ich mit ihm anfangen? Auch eine Freundin von mir hat sich auf die Reise gemacht, um für einen Augenblick inne zu halten. Bei ihrer Rückkehr war sie viele Erfahrungen reicher und hatte einige vage Ideen, wie sie sich neu orientieren könnte. Doch die Leere war noch nicht verschwunden.
Wie ihr geht es auch vielen Musikern, die eine nagende Unzufriedenheit mit ihren aktuellen Produktionen und Prozessen verspüren: kommerziell oder kompromisslos? Hardware oder Software? Die Arrangements perfektionieren oder in einem Take raushauen? So weiter machen wie bisher oder den Umbruch wagen? Aus dem Käfig der Routine auszubrechen ist nur wenigen vergönnt – die wundersame Wandlung des ehemaligen Teenie-Schwarms Scott Walker zum radikalen Avantgarde-Künstler oder die der Doom-Metal-Band Paradise Lost in Richtung Synthie-Pop bleiben Ausnahmen. Vielleicht noch spannender ist der Fall des Komponisten Elliott Carter, der in den 40ern versucht hatte, sein Publikum mit einer emotional direkten Musik für sich zu gewinnen. Desillusioniert über sein Scheitern zog sich Carter in die Wüste Arizonas zurück und entschied sich, das zu tun, was er schon immer wollte: Eine neue Musik zu entwickeln, die schwierig und unglaublich reich an Details war. So schrieb er ein geschlagenes Jahr lang und ohne einen Gedanken an die Hörbarkeit seiner Musik zu verschwenden an seinem ersten Streichquartett, das zu den anspruchsvollsten Exemplaren der Gattung gezählt wird. Zu seiner eigenen Überraschung entwickelte es sich zu seinem beliebtesten Werk überhaupt, wurde mehrfach ausgezeichnet und markierte den Anfang seiner Karriere. Carter war seinen eigenen Jakobsweg gegangen und hatte sich auf das konzentriert, was ihn als Person auszeichnete. Hatte er das Rezept für glücklich-machende kreative Arbeit gefunden?
Echt, nicht vorgetäuscht
Ein Blick auf die aktuellen Charts in der elektronischen Musik belehrt einen schnell eines Besseren. Jahrzehntelang hatte der Underground eine Art Verteidigungsmechanismus entwickelt, um kommerzielles Scheitern vor sich und dem Rest der Welt zu erklären: Zwar sei man nicht so erfolgreich wie Boybands und One-Hit-Wunder. Dafür aber mache man Kunst aus einem inneren Zwang heraus, als Ausdruck der tiefsten Gefühle, als persönliche Therapie – was bei Britney Spears vorgetäuscht ist, sei hier echt. Heute ist der Drang zu Konformität und Zielgruppenbedienung sogar dort angekommen, wo kommerzielle Erwägungen keinerlei Bedeutung haben. Wohin man auch sieht, scheint sich die Tendenz zu verstärken, auf Nummer sicher zu gehen, das zu wiederholen, was sich bewährt hat und die Formeln anzuwenden, die funktionieren. Stefan Goldmann hat in seinem berühmten Artikel „Everything Popular is Wrong“ bereits vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass eine Besinnung auf das Besondere die vielleicht einzig sinnvolle Strategie in einer Musiklandschaft darstellt, die mit Kopien von Kopien und austauschbaren Ansätzen übersättigt ist. Warum also fällt es so vielen Musikern schwer, diesen Argumenten auch Taten folgen zu lassen?
Zweifelsohne spielt die Post-90er-Desillusionierung eine große Rolle, der Augenblick, in dem es plötzlich nicht mehr möglich war, aus eigener Kraft aus dem Schlafzimmer heraus die Welt zu erobern. Sein eigenes Ding durchzuziehen, so die generelle Einschätzung, ist gerade noch den wenigen Stars dieser kurzen Hochphase des Underground möglich. Für alle anderen führe es schnurstracks in die Bedeutungslosigkeit. Doch es gibt noch weitaus grundlegendere Gründe. Der IT-Experte und Hobby-Philosoph Paul Graham führt viele unserer inneren Zerwürfnisse in seinem trefflich benannten Essay „How to do what you love“ darauf zurück, dass wir aufgrund eines Mangels an Einschränkungen unfähig geworden sind, das zu erkennen, was wir tief im Herzen wollen. Dass so viele Produzenten keinerlei künstlerischen Abhängigkeiten mehr eingehen und nach „Freiheit“ streben, macht die Sache eher noch schwieriger. Denn ohne eine sehr deutliche und klare Vision davon, wohin uns diese Freiheit führen soll, fühlen wir uns in ihr nur all zu leicht verloren. Grahams Kollege Mark Manson hat den Wesenskern dieses Dilemmas trefflich herausgearbeitet: „Wir existieren auf dieser Erde für eine unbekannte Zeitspanne, in der wir bestimmte Dinge tun. Manche von ihnen sind wichtig. Andere sind unwichtig. Die wichtigen Dinge erfüllen unser Leben mit Bedeutung und Glück. Mit den unwichtigen schlägt man eigentlich nur die Zeit tot. Wenn Leute also fragen: „Was soll ich mit meinem Leben tun“ oder „Was ist der Sinn meines Lebens?“, dann fragen sie eigentlich in Wahrheit: „Wie kann ich meine Zeit nutzen, sodass sie wichtigen Dingen gewidmet ist?“ Sowohl Graham als auch Manson sind sich einig darin, dass ein Konflikt zwischen wirklicher Kreativität und Anerkennung von außen besteht. Die Anerkennung, die wir für unsere Leistungen erhalten, so Graham, dürfe kein Ziel an sich sein, weil man letztendlich Anerkennung für alles bekommen könne, solange man es nur gut genug mache. Der Ruhm komme von selbst.
Rat und Tat
Diese Perspektive ist zweifelsfrei recht einfach für Graham, der schon früh im Leben die ersten Millionen auf dem Konto hatte. Doch hat sich um das Thema Selbstfindung eine umfangreiche Literatur gebildet, die auch finanziell weniger gut Betuchten mit Rat und Tat zur Seite steht. Während vieles davon eher in den Bereich der Esoterik zu verorten ist, lassen sich aus den unzähligen Empfehlungen auch einige wirklich hilfreiche Ansätze ableiten. Einer der Genreklassiker ist das Buch „Die sieben Wege zur Effektivität“ von Stephen R. Covey, das die berühmte Vierfelder-Matrix von Dwight D. Eisenhower als Methode entwickelt, genau den Aktivitäten aus dem Weg zu gehen, die Manson als „Zeittöter“ beschreibt. Covey beschreibt einen Weg, der von einem Zustand der Abhängigkeit von Erwartungshaltungen oder finanziellen Erwägungen zur Selbstständigkeit führt und von dort zur Interdependenz, also einer Situation, in der man mit anderen agiert und Netzwerke aus fruchtbaren gegenseitigen Abhängigkeiten und Impulsen bildet. In der Musik entspricht das einem Weg weg vom anfänglichen, gesunden Kopieren und Nachahmen hin zur Entwicklung und Förderung einer eigenen Sprache und von dort zu einem fortlaufenden Austausch mit der Umwelt und den eigenen Bedürfnissen.
Ausgehend von sehr ähnlichen Erwägungen hat die Life-Coachin Kathy Caprino eine Reihe von Empfehlungen entwickelt, welche das Erreichen von Selbstständigkeit und Interdependenz möglich machen sollen:
• Unterscheide genau dazwischen, was funktioniert und was nicht. Wer mit der aktuellen Situation unzufrieden ist, sollte nicht alles Erreichte über Bord werfen, sondern erkennen, was einen beim Produzieren zufrieden mache und was unglücklich. Ersteres solle man unbedingt beibehalten.
• Brich nicht sofort alle Brücken ab, sondern fange schon in der jetzigen Situation mit der Analyse an. Um so früher man versteht, wo die kritischen Punkte liegen, um so mehr entwickelt man ein neues Selbstbewusstsein sowie ein Gefühl der Selbstbestimmung.
• Erkenne, wer du bist und entwickle deine persönliche Geschichte. Wofür schätzen dich andere ganz besonders? Worin unterscheidet sich das, was du tust, von dem was die besten in deinem Bereich tun? Wofür warst du ganz zu Anfang deines Weges in der Musik bekannt? Was sind deine Absichten im Leben und bei welchen Werten würdest du niemals Kompromisse eingehen?
Konkrete Techniken
Für den letzten Punkt – das Erkennen der eigenen Persönlichkeit – gibt es eine Menge konkreter Techniken. Covey empfiehlt, die Antworten auf die großen Fragen zu visualisieren. Der Coach Jack Canfield zieht eine Technik namens „30-30-30“ vor, bei der man nicht nach einem einzigen Lebensziel forscht, sondern zunächst einmal 30 Dinge notiert, die man im Leben tun möchte, 30 Dinge, die man gerne besitzen würde und 30 Dinge, die man gerne wäre, bevor man stirbt. Der Pianist James Rhodes betont, man müsse sich immer wieder vor Augen halten, wie einfach es sei, Veränderungen durchzuführen – in einer Stunde ließen sich die Grundzüge des Klavierspielens verstehen, für wenige Hundert Euro Klaviere auf eBay finden und danach heiße es einfach nur, so viel wie möglich zu üben. Die Schriftstellerin Julia Cameron wiederum schreibt jeden Tag, gleich nach dem Aufstehen, drei Seiten mit dem, was ihr spontan in den Kopf kommt. Diese „Morgenseiten“ gehen um den reinen Spaß am Schreiben ohne Konzepte und Hintergedanken und führen oftmals zu ungefilterten Ergebnissen, die einen wieder näher an das heran führen, was man liebt. Dass sich diese Ansätze recht problemlos auch auf die Musik übertragen lassen, beweisen die „One-Hour-Drones“, die der Elektronik-Produzent Deadbeat eine Zeit lang jeden Morgen produziert hat.
Eine der wichtigsten Empfehlungen überhaupt ist Mansons Ratschlag, sich unbedingt mal wieder zu blamieren. Jeder, der etwas Wichtiges tun wolle, werde sich zwangsläufig zu Anfang in die Nesseln setzen – weil es nämlich verdammt schwer sei, etwas wirklich Wichtiges zu tun. Vor allem müsse man unbedingt Dinge machen, bevor man erkennen könne, ob man sie mag. Eine neue Perspektive im Kopf zu erarbeiten sei nicht viel wert ohne den Mut, sie auszuprobieren. Wem das zu radikal klingt, der kann die Angelegenheit auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten: Da jeder Job und jeder kreative Ansatz in Folge der Digitalisierung schon bald ohnehin nichts mehr wert sein könnte, hat man sogar mit drastischen Umbrüchen recht wenig zu verlieren. Das lehrt einen schon der Jakobsweg: Nicht das Erreichen des Ziels ist die eigentliche Aufgabe. Sondern das Hinter-sich-Lassen der alten Heimat und Gewohnheiten.