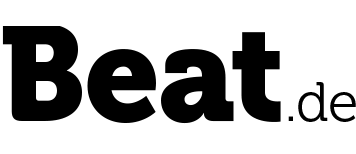Das Konzert ist wieder der Mittelpunkt der Musikwelt. Aber ist es überhaupt noch als solches erkennbar? Musik wird zum Träger für immer größere, spektakulärere Events, bei denen die Technologie eine immer prominentere Rolle einnimmt. Mit dem Einsatz biometrischer Armbänder steht der nächste Schritt kurz bevor – ist dabei überhaupt noch Platz für soziale Interaktion?

Manche Gästelisten sind länger als andere. Als Hardwell seine „I am Hardwell“-Tour (siehe auch Musik-Tipps in dieser Ausgabe) nach Indien brachte, enthielt sie knapp 75000 Namen und damit schätzungsweise so viele Tänzer wie ganz Deutschland an einem Freitagabend. Größe allein ist aber nicht alles. Während die traditionelle Club-Szene von der Vielfalt der auflegenden DJs geprägt ist und sogar ein relatives Relikt wie die vor mehr als zehn Jahren installierte LED-Wand des Berliner Watergates immer noch als ein technisches Highlight durchgeht, mutete der Auftritt in Mumbai wie von einem anderen Stern an: Da stand eine einzige Person auf einer gigantischen Bühne und wurde von einem schier unerschöpflichen Fundus an Spezialeffekten und Videoprojektionen unterstützt. Auch wenn die Auftritte von Hardwell im Guinness'schen Sinne keine Zuschauer-Rekorde brechen, sind sie zweifelsfrei umwälzender Natur: Sie sind weltweit wiederholbar, benötigen nur einen minimalen Personalaufwand und platzsparendes Equipment, das nicht mehr mit 24-Tonnern und Lastenanhängern transportiert werden muss. Damit treibt „I am Hardwell“ eine inzwischen knapp 50-jährige Entwicklung auf die Spitze, bei der immer weniger Menschen stets bombastischere Events für immer mehr Besucher durchführen. Die Rationalisierung des Arbeitsprozesses wird in diesen Veranstaltungen so deutlich wie nie zuvor. Bewegt sich das Konzert in Richtung eines Events, bei dem nicht die Musik oder der Kontakt mit anderen Gästen, sondern die Beschäftigung mit Technologie auf und vor der Bühne zum eigentlichen Inhalt wird?
Dass Musik nicht nur einen kleinen häuslichen Kammermusikkreis zusammenführen kann, sondern imstande ist, ganze Stadien zu füllen, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die erste historische Annäherung an das klangliche Massen-Spektakel fand am 17. Juli 1777 statt, als 50 Musiker auf ein Floß stiegen, die Themse entlang trieben und Händels „Wassermusik“ aufführten. Während König und Gefolgschaft dem Werk auf ihren im Fluss verteilten Booten lauschten, folgten unzählige Londoner dem Spektakel vom Ufer aus. 1749 toppte der Komponist das Event noch mit seiner „Feuerwerksmusik“, bei der so viel Böller zum Einsatz kamen, dass ein Gebäude Feuer fing. Es sollte lange dauern, mehr als 200 Jahre um genau zu sein, bis eine neue Musikergeneration den für seine Gigantomanie bekannten Händel überbieten konnte. In einem spannenden Rückblick hat der Live-Musik-Experte Mark Cunningham beschrieben, wie sich ein gänzlich neues Massenphänomen entwickelte: schrittweise und über eine Handvoll legendärer Konzerte. Als einer der frühesten dieser Schritte gilt die 79er-Tour von Led Zeppelin. Auch wenn die Band nicht die erste war, die mit Türmen aus Lautsprechern riesige Menschenmengen beschallte, so revolutionierte sie doch das Konzept des Stadium-Konzerts durch zwei Innovationen. Zum einen hatte ihr Manager Peter Grant es durch knallhartes Taktieren verstanden, dass Led Zeppelin an jedem Abend der einzige Act im Line-Up waren. In einer Zeit, in der die meisten Konzerte zur Risikominimierung noch immer von mehreren Gruppen bestritten wurden, stellte dies eine ungewöhnliche Strategie dar, doch sorgte sie dafür, dass auch wirklich jeder Gast ein Fan war. Zu Berühmtheit gelangte die Tournee außerdem durch den Einsatz riesiger Videos. So wurden Sänger Robert Plant und die Instrumentalisten auf eine Kinoleinwand projiziert, wodurch sogar Zuhörer in den entferntesten Rängen in das Event hineingezogen wurden, während sie den Zuschauern in den vordersten Reihen wie Götter erscheinen mussten. Zwei Jahre später fügten Genesis auf ihrer Abacab-Tournee ein weiteres inzwischen selbstverständliches Puzzlestück hinzu: Dank der Vari-Lite-Technologie konnten die von der Decke hängenden Spots nun den Bewegungen der Musiker folgen und damit eine weitaus dynamischere Dramaturgie entwickeln.
Auf seiner „Glass Spider“-Tour führte David Bowie 1987 den kontinuierlichen Kostümwechsel ein sowie die Integration choreografischer Elemente, die den Weg für die im Sekundentakt vorgenommenen Metamorphosen einer Lady-Gaga bereiteten. Zwischen diesem epischen Moment und U2s Zoo-TV-Tour, auf der Video und digitale Technologien einen festen Platz in der Konzertwelt erhielten, liegt die vielleicht umwälzendste Tournee überhaupt, die „Steel Wheels“ der Rolling Stones. Deren alles bisher Gesehene übersteigende Gerüstkonstruktion schuf eine eigenständige Welt auf der Bühne. Mit „The Wall“ hatten Pink Floyd das zwar knapp zehn Jahre vorher schon einmal versucht, waren jedoch an den gewaltigen Kosten gescheitert. Die Stones lösten das Problem, indem sie Eintrittspreise verlangten, die zum damaligen Zeitpunkt schlicht absurd erschienen. Doch verkauften sie jedes Konzert gnadenlos aus. Damit wurde eine nach oben offene Preisspirale in Gang gesetzt, die viele der Beteiligten reich machte, gleichzeitig aber auch voraussetzte, dass jeder Konzertbesuch größer, spektakulärer und staunenswerter sein musste als der vorige.
Elektronischer Gegenentwurf
Während Rockmusik im Stadionbereich die Hoheit nahezu vier Jahrzehnte unangefochten für sich beanspruchte, reifte im Bereich der elektronischen Musik ein Gegenentwurf heran. Die Rolle, welche die Massen-Events von Jean-Michel Jarre dabei einnehmen, kann kaum überschätzt werden. Im gleichen Jahr als Led Zeppelin auf ihrer revolutionären Konzertreise über mehrere Termine verteilt vor knapp 400.000 Zuschauern spielten, mobilisierte Jarre auf dem Place de la Concorde locker eine Million Besucher an einem einzigen Abend. Mit der Illuminierung ganzer Stadtteile sowie der Kombination aus Feuerwerk und Lasern stand der Performer selbst hierbei zumindest optisch eher im Hintergrund, während Musik und Visuals gemeinsam die Dramaturgie vorantrieben.
Spätere Events, darunter das auf einem treibenden Floß gegebene Docklands-Konzert sowie ein 3,5-Millionen-Gig in Moskau 1997, trieben dieses Konzept immer weiter auf die Spitze. Ob hier überhaupt noch live performt wurde oder nicht, spielte eher nur für Hardcore-Fans beim Betrachten der DVD eine Rolle. Während der Events selbst war der gemeine Beobachter von der Aktion auf der Bühne ohnehin zu weit entfernt um etwas zu erkennen und hätte sicherlich Verständnis dafür gehabt, dass bei der Synchronisation von Aktivitäten, welche auf das Stromäquivalent einer mittleren Kleinstadt angewiesen waren, das menschliche Element notgedrungen ein wenig zu kurz kam. Als Jarre 1998 mit einer für seine Verhältnisse bescheidenen Performance vor 800.000 Zuschauern das bisher letzte seiner Megakonzerte gab, markierte das zugleich den Beginn einer neuen Ära: Die Elektronik war nun reif für die heiligen Hallen des Rock.
In den Niederlanden besuchte der Promoter Duncan Stutterheim das erste Fußballspiel seines Lieblingsvereins Ajax in der neuen Vereins-Arena und beschloss augenblicklich, dort ein House-Event zu veranstalten. Zur ersten „Sensation“ kamen 1500 Gäste, zu den nachfolgenden schon bald 40.000. Und weil man das Konzept inzwischen in die ganze Welt exportiert, wird auch diese Zahl nahezu jährlich überboten. Den zweifelsohne größten Schritt in Richtung Rock-Erlebnis nahm die Club-Musik derweil 2006 mit dem Auftritt von Daft Punkt auf dem amerikanischen Coachella. Aus einer Pyramide heraus, die futuristisches Bühnen-Requisit und riesiges LED-Display zugleich war, entfachte das Duo über eine Stunde lang einen perfekten Sturm aus Hits, Edits und unveröffentlichtem Material.
Sogar zehn Jahre später und über grobkörnige Youtube-Videos verursachen die ersten Minuten, in denen eine mächtige Vocoder-Stimme aus der Dunkelheit aufsteigt, zum Rhythmus wird und dann ohne Warnung in einen von krachenden Gitarrensamples durchflashten Electro-Beat explodiert, Gänsehaut pur. Weil der Auftritt zudem die Grenzen zwischen Konzert und DJ-Set endgültig einriss, war elektronische Tanzmusik endgültig im konservativen US-amerikanischen Mainstream angekommen und begannen sich die Künstler auf ihrer Suche nach der aufpeitschendsten und aufputschendsten Show gegenseitig zu überbieten. Die LED-Wände streckten, die Bühnen dehnten sich, bis sie, in der Zauberland-Konstruktion des belgischen Tomorrowland-Festivals, auf fantastische Dimensionen heranwuchsen. Spätestens als 180 leuchtende Kugeln über den Köpfen der Raver schwebten, stand die Eröffnungszeremonie der Sensation derjenigen der Olympischen Spiele um nichts mehr nach.
Tragbare Kontrolle
Damit freilich war ein zwischenzeitliches Plateau erreicht, da man sich ernsthaft fragen muss, was nach dem Fallschirmsprung von Martin Garrix zur Sensation Dubai sowie der aktuellen Feuerwerk-Schlacht auf dem Mysteryland-Festival überhaupt noch kommen kann. Während Jonas Schmidt, Kreativdirektor des Hardcore-Labels Q-Dance, bereits von Fluggeschwadern aus Dronen träumt, dürfte die weitaus unscheinbareren „Wearables“ – Armbänder, die biometrische Daten sowie die aktuelle Position und das Aktivitätslevel der Besucher messen – eine deutlich einschneidendere Rolle spielen. Mit ihrer Firma Lightwave hat die Unternehmerin Rana June Pionierarbeit in diese Richtung geleistet. Bei einem mit Pepsi veranstalteten Event wurden die Gäste dazu animiert, ausgiebiger zu tanzen. Sobald ihr über die Armbänder gemessenes Aktivitätslevel einen kritischen Punkt überschritt, erhielten sie kostenlose Freigetränke. Diese noch recht primitiv anmutenden Konzepte könnten schon recht bald von weitaus anspruchsvolleren ersetzt werden. So wäre es denkbar, die Auswahl der Musik auf den Bühnen von den Zuschauerabflüssen und -ankünften abhängig zu machen und entsprechend gegenzusteuern, sobald das Interesse sinkt. Man denkt bei solchen Lenkungsmanövern sofort an eine kontrollierende Funktion der Technologie, aber die Beweggründe der Entwickler gehen oftmals in komplett andere Richtungen. Für jemanden wie den Tech-Unternehmer Nick Panama steht der Gedanke im Vordergrund, dass das Live-Erlebnis so packend sein sollte, dass niemand überhaupt erst auf die Idee kommt, sein Smartphone aus der Hose zu holen. Diesem Ideal ist auch die Firma Live Media Group verpflichtet, die für hochwertige Videoaufnahmen der Konzerte sorgt, sodass die Gäste sich diese nachher kostenfrei herunterladen können, statt sich auf ohnehin miserable Eigenmitschnitte zu konzentrieren. Gleichzeitig sehen andere genau in der Möglichkeit des Streamings eine hervorragende Option, das Live-Erlebnis medial zu erweitern: Wenn bei einem Festival drei Lieblingsbands gleichzeitig spielen, besucht man eben nur eine live und verfolgt die anderen Konzerte auf dem Handy.
Bei diesen endlos fortsetzbaren Gedankenspielen geht es nicht nur um die Frage nach dem Verhältnis von Technologie zum Menschen, sondern genauso um die Balance zwischen dem Konzerterlebnis als einer Form des totalen Aufgehens in einer Illusion und einem sozialen Erlebnis, das man mit vielen anderen teilt. Wenn man Lehren aus der Geschichte ziehen möchte, dann die, dass das Konzert nicht aus dem Austarieren dieser Pole, sondern ihrem ständigen Spannungsverhältnis seine Energie zieht. Die Entwicklung des klassischen Marshall-Verstärkers begann beispielsweise nicht damit, dass Bands so laut wie möglich sein wollten – sie konnten die eigene Musik schlicht nicht mehr aus dem Kreischen und Schreien der Gäste heraushören. Später dann drehten sie den Spieß um und zwangen ihr Publikum mit nahezu körperverletzender Lautstärke zum euphorischen Aufgehen im Krach. Man kann über aktuelle EDM-Performances wie „I am Hardwell“ die Nase rümpfen. Doch scheint es, als ob sie diesen Spagat teilweise weitaus besser transportieren als die vorhersehbaren Auftritte der Altstars oder „seriöse“ Gigs, bei dem selbst ein zu lautes Räuspern verpönt ist. Manchmal ist es schließlich nicht nur die Technologie, die einem menschlichen Erlebnis im Weg steht – manchmal sind wir es selbst.
Dieser Artikel ist in unserer Heft-Ausgabe 127 erschienen.