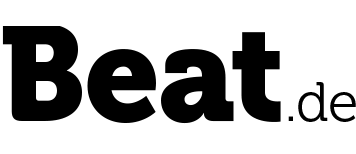Musik spielt für die meisten Menschen schlicht keine Rolle mehr. Während sich unser Alltag zunehmend politisiert und die Welt auf eine Krise zusteuert, mutet es unzeitgemäß und passiv an, sich hin zu setzen und einfach nur den Klängen zu lauschen. Die Zeichen stehen auf einen tiefen Wandel unserer Art Musik zu konsumieren – und er wird keinen Beteiligten verschonen.

Erkenntnisse ereilen einen in den seltsamsten Situationen. Am zweiten Morgen unseres Geburtsvorbereitungskurses fragte die Leiterin in die Runde, was wir alle am Vorabend, nach dem anstrengenden Programm des Vortages, noch gemacht hätten. Es war eine Smalk-Talk-Frage, die wir jedoch angesichts der frühen Uhrzeit durchaus dankbar annahmen. Der Großteil der Teilnehmer berichtete, noch ein oder zwei Folgen ihrer aktuellen Lieblings-Serie geschaut zu haben. Andere hatten kleine Aufgaben im Haushalt erledigt. Vereinzelte hatten sich kurz unterhalten oder waren einfach unmittelbar ins Bett gegangen. Die Aussagen waren komplett unbemerkenswert und doch nagte etwas an mir. Erst später ging mir auf, was es war: Nicht ein einziger hatte zu Protokoll gegeben, zumindest ein wenig Musik gehört zu haben. Wenn es sich hierbei um einen Einzelfall handeln würde, wäre dies wohl kaum Grund zur Sorge. Die Realität sieht aber eher so aus, dass dieses Szenario jeden Abend immer wieder aufs Neue statt findet. Es ist viel darüber gesprochen worden, dass Musik an Wert verloren habe, weil sie verschenkt und verscherbelt werde, weil es zu viel von ihr gebe und nicht genug davon gut genug sei, weil jeder heute meint ein Komponist sein zu können und wir von den lauwarmen Ergebnissen berieselt werden wie von einer Dusche, die sich einfach nicht ausschalten lässt. All das mag zutreffen. Doch handelt es sich dabei eher um den Nebenschauplatz einer weitaus dramatischeren Entwicklung.
Insbesonders für neue Label oder unbekannte Künstler spitzt sich die Lage zu. Sogar die auserwählten Wenigen, die in den Medien eine Erwähnung finden, deren Tracks vielleicht sogar in einigen Playlist auftauchen oder die eine Einladung zum Interview bekommen, können ein Lied davon singen, wie leidlich gering sich all das auf die Bilanz auswirkt – ganz egal, ob man diese in Seitenaufrufen, Verkäufen, Likes oder aufmunternden Worten misst. Ganz offensichtlich greifen einstmals routinemäßig abrufbare Mechanismen und Kausalketten heute einfach nicht mehr. Es ist keinesfalls so, dass Musikmagazine nicht mehr gelesen würden, dass niemand mehr das Radio einschaltet oder Videoclips nicht ein Publikum erreichen. Doch führt von diesen „Portalen“ kein auch nur ansatzweise zwingender Weg mehr zum Produkt oder zu einer näheren Beschäftigung mit ihm. Einst berichtete mir der ehemalige Besitzer eines alternativen Plattenladens in Berlin von einer Vergangenheit, als Kunden mit dem in kleinen Auflagen erscheinenden Kultmagazin „Auf Abwegen“ in den Laden kamen und eine Sammelbestellung aller Platten aufgaben, bei denen sie vorher ein Kreuz neben die Rezension gemacht hatten. Eine solche Wirkung entfaltet heute nicht einmal eine euphorische Besprechung auf Pitchfork, deren stündliche Zugriffsraten die Gesamtauflage der „Auf Abwegen“ bei Weitem in den Schatten stellen. Die einstmals spürbare Dringlichkeit, bestimmte Platte einfach besitzen zu müssen, scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.
Verschiebungen im Konsumverhalten
Natürlich wäre die Behauptung falsch, Musik bedeute uns rein gar nichts mehr. Ein Teil des Phänomens beruht schlicht auf Verschiebungen im Konsumverhalten. 30 neue Songs schickt mir Spotify jede Woche, 120 im Monat, fast 1500 im Jahr, alle erstaunlich präzise kuratiert und auf meinen individuellen Geschmack abgestimmt. Hinzu kommen Playlists für jeden Anlass und jede Tageszeit, die sich schon bald über biometrische Sensoren an unsere Stimmung, Aktivitäten und Bedürfnisse anpassen werden. Ein Album, ganz egal wie gut es sein mag, wird niemals mit einem derart personalisierten, dynamischen, überraschenden und zudem (wenn man von Werbeunterbrechungen beziehungsweise monatlichen Mitgliedschaftsbeiträgen absieht) kostenlosen Angebot konkurrieren können. Nicht einmal die riesigen Kataloge der ganz großen Major-Labels sind für sich allein genommen umfangreich genug, außerhalb der Cloud Bestand haben zu können. Einer einzelnen Veröffentlichung Aufmerksamkeit zu verleihen, die über ihre Rolle im Stream hinausgeht, wirkt da ungefähr so sinnvoll, wie eine Analyse jedes einzelnen Tracks in einem 10-Stunden langen DJ-Set. Freilich: Das DJ-Set auf Spotify, Deezer oder Tidal endet gar nicht mehr. Wer heute noch künstlerisch ambitionierte EPs oder Alben veröffentlicht, tut dies deswegen im Wesentlichen für sich selbst – der Rest der Welt klinkt sich unterdessen in den uferlosen Mix ein und lässt sich auf den Schwingen der Algorithmen von einer Song-Insel zur nächsten tragen.
Auf einer rein rationalen Ebene spricht nichts dagegen, das diese Form des Hörens ebenso befriedigend sein könnte wie das Durchforsten der eigenen Plattensammlung. Aktuell zumindest scheinen die meisten Playlists aber eher als Hintergrundberieselung für morgendliches Joggen, das sonntägliche Putzmanöver oder das Überbrücken der Wartezeit zwischen Auftauen und Verspeisen einer Salamipizza genutzt zu werden – Tätigkeiten, die ein tieferes, emotionaleres Hören eher nicht begünstigen. So macht sich allmählich ein Gefühl der Bedeutungslosigkeit breit. Es mag noch ein wenig erhitzte Gemüter in den Amazon-Bewertungen geben, wenn sich Helene Fischer auf dem neuen Album in Richtung Dancefloor bewegt. Doch die Themen, die wirklich die Gemüter erregen, sind heute anderswo zu finden: Bücher, die auf 300 Seiten nichts anderes diskutieren als die Frage nach der besten Messerklinge und der richtigen Schneidetechnik erzielen Millionenauflagen. Ein hochkomplexer, mit Statistik-Vokabeln gepfefftert Post der Foodbloggerin Denise Minger über die umstrittene „China Study“ steht aktuell bei fast 1500 Kommentaren. Musik spielt gefühlt nur dann eine Rolle, wenn sie sich der Krücke eines anderen Mediums bedient. Unabhängig von der Qualität der Kompositionen ist es zumindest bemerkenswert, wie tief und vielschichtig noch immer über den Soundtrack zu „Bladerunner: 2049“ diskutiert wird - ohne die Einbettung in eine legendäre Franchise und die teilweise berauschenden Bildwelten Denis Villeneuve's jedoch würden die knarzenden Analog-Klänge wohl keinen Replikanten hinter dem apokalyptischen Ofenrohr hervorlocken. Nicht einmal diejenigen, die berufs- und berufungsmäßig mit Musik zu tun haben, können noch die Leidenschaft aufbringen, außerhalb der regulären Arbeitszeiten die Wärme des heimischen Sofas auf zu geben. Vor kurzem war ich auf der Listening Session eines bekannten Techno-Labels, bei der das lang erwartete Release eines namhaften Künstlers präsentiert wurde. Wir waren zu sechst. Nicht einmal das jedoch ging als Misserfolg durch.
Reizüberflutung
Der allgegenwärtige Zustand der Reizüberflutung ist eine der Hauptursachen für den wahren Bedeutungsverfall von Musik. Handys, die bei jeder neu eingegangen eMail knattern, Browser die uns auf Updates aufmerksam machen, soziale Medien die im Sekundentakt aktualisiert werden, aberwitzig schnell geschnittene Videos, maximal laut abgemischte Songs, das ununterbrochene Eingestöpseltsein in Nachrichtenmeldungen, Podcasts und Info-Feeds zehren tagsüber an unseren Energiereserven. Wenn wir dann am Abend nach Hause kommen, sind unsere Körper und Gehirne schlicht nicht mehr darauf eingestellt, herunter zu fahren. Wenn Serien wie „Games of Thrones“ oder „The Waking Dead“ auf einer Erfolgswelle schwimmen, die man ihrer extremen visuellen Ästhetik und krassen Geschichte niemals zugetraut hätte, dann liegt das auch daran, dass sie passiven (entspannenden) Fernsehkonsum mit stimulierendem (das Neuronenfeuer fütterndem) Storytelling zum perfekten Unterhaltungspaket verbinden. Mit der drastischen sensorischen Einschränkung reinen Musikhörens jedoch kommen wir schlicht nicht mehr zurecht. Es ist ein Trend, der noch zusätzlich erschwert wird durch eine Arbeitswelt, in der die Grenzen der Belastbarkeit immer wieder auf die Zerreißprobe gestellt werden, in der die email am Sonntag, das Home Office nach Feierabend und der Abschied vom Urlaub sowohl für Freiberufler als auch Angestellte keine Ausnahmen mehr darstellen. Musik verlangt uns nicht nur Konzentration ab, sondern auch Interesse, emotionale Beteiligung, die Bereitschaft, an unbekannte Orte zu gehen oder bereits Bekanntes neu zu durchleben. Dafür reicht oftmals schlicht nicht mehr die Kraft.
Musik erscheint auch in anderer Hinsicht immer mehr als unzeitgemäß. So spitzt sich überall um uns herum die Lage zu: Wir scheinen uns mittelfristig in Richtung eines ökologischen Kollaps zu bewegen; Viele von uns sind durch Stress schwer krank geworden; scheinbar banale Dinge wie die richtige Ernährung sind zu ebenso komplizierten wie kontroversen Themen geworden; rechte Ideologien und Volksverhetzer gelten plötzlich als „Alternative“; viele Regionen, ja ganze Kontinente sind gequält von Hunger, ausgemergelt von Krieg und Not. Die Politisierung des Alltäglichen nach einer langen Phase der oberflächlichen Ruhe zwingt jeden von uns dazu, uns entweder für passives Aussitzen oder entschiedenes Agieren zu entscheiden. Die Welt wird zunehmend offener, offensiver und öffentlicher, einstmals ferne Abstraktionen betreffen uns plötzlich ganz unmittelbar. Im Gegensatz dazu ist das aufmerksame Musikhören ein Akt, der uns nach innen führt, ins Private und Persönliche, der uns aus der physischen Realität entführt. All das wirkt kaum mehr angemessen, wenn um uns herum die Welt in Flammen steht. Die Potenz von Musik, politischen Ideen und Visionen eine Form und Sprache zu verleihen, scheint weitestgehend aufgebraucht, da sich einstmalige Protestbewegungen wie Punk oder Jazz zu kodifizierten Genres fixiert haben, der Hippie-Spirit des 70er Jahre Rocks allzu handzahm erscheint und der größte Teil der neuen Produktionen sich nur noch als reines Entertainment versteht.
Der Fluch des Funktionalen
Der kleine Bereich, der außerhalb des Politischen noch bleibt, wird von funktionalen, zweckgebundenen, praktischen und pragmatischen Erwägungen bestimmt. Junge Eltern haben andere Sorgen als die Frage, ob Mahler in seiner neunten Symphonie die Atonalität vorwegnahm. Wer unter einer chronischen Darmkrankheit leidet, zieht vermeintlich größeren Nutzen aus einem glutenfreien Brötchen als einem perfekt produzierten Triangelgroove. Und angesichts der unendlichen Wahlmöglichkeiten im kommerziellen Warenparadies kann es tatsächlich manchmal als lohnenswerter erscheinen, 300 Seiten über Messerklingen zu wälzen als sich damit auseinander zu setzen, ob die neue Aphex Twin wirklich so gut ist, wie alle meinen. Die Bereiche, in denen Musik noch funktioniert – im Konzert und Club oder als Installation im Museum – sind ausgerechnet diejenigen, in denen sie hinter einem anderen, als weitaus wichtiger empfundenen Gut zurücktritt: Dem Kontakt mit anderen, dem sozialen Element, das in der beschriebenen Dauerstresssituation unserer Alltags zu kurz kommt, dem Druckabbau durch Feiern, Drogen und Exzess.
Es beschleicht einen eine gewisse Hoffnungslosigkeit angesichts dieses freien Falls. In Wahrheit aber kann man das Nahen der Talsohle auch als erstes Zeichen einer bevorstehenden Veränderung werten, zu der jeder einzelne direkt aufgerufen ist. Wenn wir der Musik wieder zu mehr Wert verhelfen wollen, müssen wir das Vergangene hinter uns lassen, auf die Zeichen der Zeit achten und aus ihnen die richtigen Schlüsse ziehen. Das kommt letzten Endes auch uns selbst zu Gute. Denn nur eine Musik, die einen spürbaren Bezug zu den neuen Realitäten hat, hat letzten Endes auch wieder Relevanz für unser eigenes Leben.