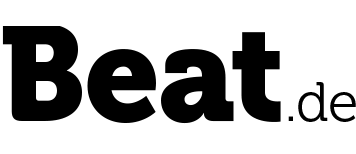Eine ganze Generation von Musikern betete ein simples Mantra herunter: Kultiviere eine starke Online-Präsenz und baue in den sozialen Netzwerken eine Fangemeinde auf – schon wirst du mit LP- und CD-Verkäufen, steigenden Streaming-Zahlen und ausverkauften Konzerten belohnt. Inzwischen behaupten manche Experten schlicht: Die sozialen Medien sind tot. Wie konnte das passieren? Und: Was sind die Konsequenzen?

Der Erfolg sollte sich eigentlich von alleine einstellen. Laut aktuellen Daten tummeln sich auf Facebook zwei Milliarden und auf Instagram eine Milliarde Nutzer, die vermeintlich alle darauf warten, auf die nächste Single oder das kommende Albumprojekt zu klicken. Worum es letztendlich nur noch gehe, so Medium.com, sei es, diese riesige Zielgruppe zu erschließen und „die eigenen Songs wie wild zu promoten“. Wie nun aber immer mehr Musiker*innen feststellen, geht diese scheinbar so einfache Rechnung nicht auf. Obwohl sie jeden Tag brav und artig mehrere Posts pro Tag herausfeuern, wirken ihre Konten eher wie Friedhöfe. Als sich das britische Elektronik-Duo Swayzak vor einigen Jahren auf Facebook darüber wunderte, dass sie 10.000 Fans hätten, aber praktisch nichts verkauften, wurden sie als Dank für diese ehrliche Enttäuschung mit Häme überschüttet. Seitdem ist eine neue Zeitrechnung angebrochen, Swayzak sind weitestgehend von der Bildfläche verschwunden und ihre Kollegen haben aus der Episode gelernt: Sich zu beschweren, traut sich heutzutage nahezu keiner mehr und so wird trotz mangelnden Feedbacks eifrig weitergepostet, was das Zeug hält - oftmals ohne, dass auch nur ein Fan reagiert.
Wer sich als Leser in der geschilderten Lage wiedererkennt ist damit nicht allein. Selbstverständlich gibt es noch immer Mega-Profile, bei denen sich die Betreiber gar nicht mehr durch die schier endlose Zahl von Kommentaren kämpfen können, die sich bei jedem Lebenszeichen über sie ergießt. Wer sich aber die Mühe macht, ein paar Minuten in den sozialen Kanälen die Konten von Musikern oder auf Musikmagazinen zu analysieren, wird rasch feststellen, dass dies die Ausnahme darstellt. Sogar Künstler mit über hunderttausend Anhängern kommen regelmäßig kaum über ein paar nach oben zeigende Daumen pro Post hinaus. Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschärft, sodass inzwischen einige Experten bereits von dem „Tod des Organic Reach“ sprechen. Was genau bedeutet das?
Opfer des eigenen Erfolgs
Wer auf Facebook ein Konto eröffnet und die ersten Kontakte aufbaut, geht davon aus, dass jeder davon einen potentiellen neuen Fan darstellt. In Wahrheit aber ist ein Like nur dann ernsthaft etwas wert, wenn die eigenen Posts auch tatsächlich bei der jeweiligen HörerIn in der Timeline erscheinen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass dies eher selten der Fall ist. Zuckerbergs Unternehmen ist in gewisser Weise Opfer seines eigenen Erfolgs: Alleine schon wer nur 100 anderen Profilen folgt, findet sich schon bald in der Flut an Posts nicht mehr zurecht. Die meisten von uns haben aber weitaus mehr „Freunde“. FB reduziert deshalb gezielt die Menge dessen, was in der Timeline erscheint, und sortiert dazu nach Relevanz. Posts, die auf Inhalte außerhalb des Netzwerks verweisen, werden als weniger wichtig bewertet; Posts, die mehr Reaktionen (in der Form von Kommentaren, Likes und Shares) erhalten, priorisiert. Das sorgt für mehr Klarheit beim Endverbraucher, aber für Kopfzerbrechen bei Musikern und Labels. Denn ihre Fähigkeit, ohne teure Werbekampagnen die Endkundin zu erreichen, fällt ins Bodenlose. Genau diese Fähigkeit bezeichnet man als „Organic Reach“ („organische Reichweite“). Liegt sie bei 100%, erhält jeder alles und verschwindet die Botschaft in einer Flut an Nachrichten. Tendiert sie, wie aktuell der Fall, gegen 0, erscheint sie erst gar nicht bei den Fans – und dass sogar, wenn diese sich wirklich für die Inhalte interessieren würden. Umso mehr FB gewachsen ist, umso mehr ist der Organic Reach abgestürzt. Für viele Musiker bedeutet das, dass sie in den sozialen Medien schlicht niemanden mehr erreichen.
Die Entwicklung in den sozialen Medien ist Teil einer umfassenderen Entwicklung. Denn wie sich sehr leicht nachvollziehen lässt, hat sich auch bei den Suchmaschinen einiges verändert. Zum Einen sinken die Besucherzahlen für sehr viele Seiten. Der Grund: Google beantwortet Fragen zunehmend bereits auf der Ergebnis-Seite. Wer sich beispielsweise für die Wetterlage interessiert, findet die Antwort unmittelbar auf Google. Wer wissen möchte, wer Michael Jacksons „Thriller“ produziert hat, wird ebenfalls dort fündig. Genau wie Facebook ist Google dabei, zu einem sogenannten „Walled Garden“ zu werden, einem abgegrenzten Garten also, den man im Idealfall (für Google) nicht mehr zu verlassen braucht. Zu dieser Tendenz passt, dass Google es am liebsten sähe, wenn die URL-Zeile, in welcher der Name der aktuellen Webseite erscheint, leer bleibt. In der ersten Version des aktuellen Chromes, dem mit Abstand meistbenutzten Browsers der Welt, setzte man diesen radikalen Schritt zunächst um, bis man dann doch den wütenden Protesten der Netcommunity nachgab. Es ist davon auszugehen, dass Google sich damit aber nicht geschlagen geben wird. Ziel bleibt: Anwender sollen ein nahtloses Erlebnis bekommen - das Gefühl, dass sie Google niemals wirklich verlassen.
Was noch schwerer wiegt: Die zunehmend dominierende mobile Suche funktioniert nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, die für kleinere Webseiten eindeutig nachteilig sind. Wie auch in der Standard-Suche werden hier viele Fragen bereits auf der Ergebnisseite angezeigt. Diese besteht aber im Mobilbereich ohnehin aus nur einem einzigen Ergebnis. Das bedeutet beispielsweise: Es gibt Millionen Lasagne-Rezepte im Netz. Wer aber auf seinem Handy nach einem sucht, bekommt nur ein einziges davon angezeigt, beziehungsweise von der Automatik vorgelesen. Die ganze Vielfalt und vor allem Tiefe des Internets die, so verwirrend sie manchmal auch sein mochte, ihr eigentlicher Zauber war, wird verwässert, verkürzt und auf kurze, leicht verdauliche Schlagsätze eingedampft.
Dominanz der Marken
Womit wir beim Kern der Angelegenheit wären. Denn zunehmend ziehen einige wenige Seiten die überwiegende Mehrheit aller Klicks auf sich, während die anderen leer ausgehen. Es ist ein Phänomen, dass die SEO-Branche – die sich mit der Optimierung der Suchmaschinenergebnisse beschäftigt – einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat. Inzwischen weiß man: Google bewertet die Seiten bekannter Marken gezielt besser als die weniger bekannter Konkurrenten. Das war zwar tendenziell in der Vergangenheit bereits so, doch verselbstständigt sich dieser Trend zunehmend. So kommt es, dass man bei dem Suchbegriff „Sportschuh“ bevorzugt bei „Nike“ oder „Adidas“ landet und nicht bei irgendwelchen deutlich günstigeren No-Name-Sneakern. Man mag dahinter böse Machenschaften vermuten, doch wollen wir es meistens schlicht nicht anders. In einer Welt, in der sogar die Wahl einer Packung Hafermilch zum Glaubensbekenntnis geworden ist und es mehr Cornflakes-Sorten gibt, als man an zwei Händen abzählen kann, suchen wir alle nach dem Vertrauten, nach den Dingen und Namen, die wir erkennen. Die Betreiber von Online-Musikmagazinen kennen diese Problematik nur zu gut. Sie alle treten mit dem Vorsatz an, unbekannten Künstlern eine Chance zu geben und entdecken dann, dass niemand auf die sorgfältig recherchierten und leidenschaftlich geschriebenen Artikel klickt – eben, weil sie keiner kennt.
Marken und Stars liefern genau diese Vertrautheit, sogar dort, wo wir ihnen gar keine konkreten Qualitäten oder Werturteile zuordnen können. Sogar dort, möchte man hinzufügen, wo wir ihnen überhaupt keine sonderlich positiven Werturteile zuordnen. Wer gerade Lust auf Trap hat, wählt dann auf Spotify einfach wieder Drake, statt sich auf etwas Neues einzulassen. Oder spielt auf Tidal Armin van Buren, statt einer vielversprechenden neuen Trance-Künstlerin. Und wenn der italienische Pianobarde Ludovico Einaudi auf Facebook eine Werbung für sein neues Album schaltet, dann sind wir sogar dann geneigt, sie anzuklicken, wenn wir seine Kompositionen für eher glatt und schmalzig halten – einfach, „um mal reinzuhören“ oder „mitreden zu können“.
Das Ziel für jeden Musiker besteht also darin, eine Marke zu werden. Was aber genau ist eine Marke überhaupt? Google hantiert ein einfaches Kriterium: Solche Namen, die öfter unmittelbar eingetippt werden und nicht über verwandte Suchbegriffe („Nike“ statt „Turnschuh“, „Porsche“ statt „Sportwagen“), sind Marken. Und was führt dazu, dass Suchende diese Namen bevorzugt eingeben? Einerseits große Image-Kampagnen, deren einziges Ziel darin besteht, aggressiv den eigenen Namen zu pushen. Und andererseits Bekanntheit über soziale Netzwerke (und dazu gehören auch die führenden Streaming-Plattformen), also über große Follower-Communities. Diese Communities sind dabei umso umfangreicher, in umso mehr Töpfen man die Finger hat. Und so kommt es, dass Lena Meyer Landrut bis heute eine der erfolgreichsten deutschen „Marken“ ist, obwohl ihre musikalische Karriere international längst ihren Zenit überschritten hat: Mittels ihrer Jobs als Model, Synchronsprecherin und „Influencerin“ erreicht sie auf Instagram fast vier Millionen Nutzer (der Account liegt aber interessanterweise gerade brach). Das heißt in der Praxis: Wer auf Facebook, Instagram und Twitter eine Marke ist, ist es auch bei Google. Wer es dort nicht ist, ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nirgendwo. Und so besteht die Strategie der Labels – und auch, möchte man hinzufügen, ihre Stärke – darin, mit entsprechendem finanziellen Aufwand alle sozialen Plattformen zu beackern, um die Markenbekanntheit des eigenen Künstlerkatalogs zu maximieren. Inhalte, Identität und Brand sind dabei nicht mehr voneinander zu trennen. Die Virgin-Senior-Marketing-Managerin Liberty Wilson hat darauf hingewiesen, dass Content heute alles beinhaltet, was eine MusikerIn in die Öffentlichkeit bringt, vom Tweet zum Album und vom Instagram-Post zum Interview, von der Online-Anzeige bis hin zum Fan-Meet-and-Greet. Umso mehr davon, umso besser: 26 Songs brauche es heutzutage, ehe man als Artist den Durchbruch schaffe, und sogar so allgegenwärtige Acts wie Ariana Grande legen nahezu im Monatstakt eine neue Single nach, um nicht in Vergessenheit zu geraten und ihren Markenstatus nicht zu verlieren.
Bedeutet das für Sie als LeserIn, dass man die Waffen bereits strecken und sich angesichts der Überlegenheit der Majors ergeben muss? Keineswegs. Vielmehr stehen Musikern heute mehr Möglichkeiten offen denn je, ihr eigenes Publikum zu finden. Mehr dazu im zweiten Teil dieses Artikels.