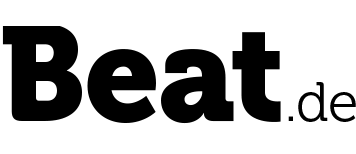Die Welle an Copyright-Klagen rollt weiter durch die Musiklandschaft. Manche Urteile sind plausibler als andere. Allgemein aber gilt: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Songs gleichen, nimmt zu. Bevor die Situation eskaliert, wird es Zeit für ein Umdenken. Algorithmische Analyse-Tools bieten hier vielversprechende Potenziale. Was du wissen solltest, erfährst du im folgenden Artikel...

Ed Sheeran - König der Urheberrechtsklagen. In den letzten Jahren hat der Sänger sich so oft gegen Plagiatsvorwürfe wehren müssen, dass eine weitere Klage kaum noch eine Schlagzeile wert erscheint. Bei seinem Prozess mit Edward Townsend aber sieht das anders aus. Gegenstand waren die auffälligen Übereinstimmungen zwischen dem Klassiker “Let's Get it On”, den Townsend 1973 mit Marvin Gaye verfasst hatte, und Sheerans "Thinking Out Loud". Nach vier zähen Jahren entschied das Gericht zugunsten von Sheeran und das alternative Online-Magazin Pitchfork meinte: “Ausnahmsweise ist Ed Sheeran einmal zu etwas gut. Manchmal braucht es eben einen Serien-Plagiatoren um die kreative Freiheit zu bewahren.” Dabei ist das Ergebnis wenig erleuchtend – und könnte auf lange Sicht eher einem endgültigen Abschied vom gültigen Copyright-System als seiner Rettung den Weg bereiten.
Zum einen verdeutlicht die Entscheidung, wie launisch die juristischen Grundlagen derzeit ausgelegt werden. Noch vor wenigen Jahren hatte der kalifornische Richter John A. Kronstadt bei dem von Robin Thicke und Pharell verfassten “Blurred Lines” die Position vertreten, dass dieser dem Gefühl und Sound von (erneut) Marvin Gaye's "Got to Give It Up" zu ähnlich sei. Die Künstler mussten Millionen nachzahlen – ein Präzedenzfall mit noch immer potentiell katastrophalen Konsequenzen. Auch ein von 200 namhaften Musikern unterschriebener offener Brief mochte die Juroren seinerzeit nicht umstimmen. So empfanden viele die Kehrtwende als Genugtuung und Hoffnungsschimmer, dass den Rechten aktiver Songschreiber wieder mehr Gewicht eingeräumt werden könnte.
Ironisch nur: “Thinking Out Loud” und “Let's Get it On” haben weitaus mehr als nur die Akkordfolge gemeinsam. Wer die beiden Songs im Hintergrund hört, könnte nur all zu leicht zu dem Schluss kommen, es laufe zwei Mal hintereinander das selbe Lied. Von Groove und Tempo über die Akzentuierung und die Instrumentierung bis hin zum Klang – das Produzenten-Team um Jake Gosling hat alles daran gesetzt, dass das Ergebnis wie eine Karaoke-Version des Gaye-Vorbilds klingt. In einem interessanten Video hat der Produzent Rick Beato zu Prozessbeginn diese eindeutigen Bezüge offengelegt. Zugleich wies er aber auch darauf hin, dass es eine Vielzahl Unterschiede gibt: Text und Thema, die harmonische Entwicklung sowie vor allem die Melodie. Es komme schlicht darauf an, worauf man den Schwerpunkt lege.
Was genau also definiert “Ähnlichkeit” im musikalischen Sinne?
Man sollte meinen, dass diese Frage leicht zu beantworten sei. Tatsächlich aber hat sie bereits seit den frühsten Jahren der Musikindustrie – sprich: seit Handel und Mozart – Anwälten und Gerichten ein sicheres Einkommen beschert. Tendenziell lassen sich zwar nur Melodie und Text schützen, während die rhythmischen Aspekte eines Tracks als Gemeingut gelten. Auf einen etwas breiteren Nenner gebracht aber geht es um all die Elemente, die einen Song einzigartig und erkennbar machen. Sogar eine Akkordfolge könnte somit unter das Urheberrecht fallen, wenn sie nur originell genug ist. Das klingt recht plausibel, ist aber in Wahrheit eine Tautologie: Das was einen Song originell macht, ist seine Originalität. Kein Wunder, dass es in den letzten 100 Jahren unzählige heftig umstrittene Fälle gegeben hat.
Dass derzeit so viele Sheeran den Rücken stärken, ist verständlich. Denn tatsächlich nimmt die Zahl der Klagen weiter zu und die Situation für lebende Musiker wird zunehmend vertrackter, weil Popmusik mit denkbar wenigen Bausteinen arbeitet und ihrem Wesen nach nicht nach Originalität strebt. Hinzu kommt, dass Songwriting-Teams wachsen. Dadurch fließen immer mehr Einflüsse in jede Produktion mit ein. Bei Kommittees mit bis zu 20 Mitgliedern, von denen manche nur einen kleinen Baustein zum Endprodukt beitragen, wird es geradezu unmöglich, sich vor möglicher “Kontamination” zu schützen. Labels hingegen verlangen genau andersherum, dass Hits idealerweise so direkt wie möglich als Vorlage für neue Songs benutzt werden, um in Streaming-Diensten in die entsprechenden Playlists zu rutschen und die Wahrscheinlichkeit algorithmischer Empfehlungen zu erhöhen. Diesen Spagat bekommen nur die wenigsten hin: Zu nah am Original und man wird als Dieb abgestempelt. Zu weit davon entfernt und die Chancen auf Erfolg schwinden.
Wer kennt wen?
Als sei dies noch nicht schwierig genug besteht eine entscheidende Frage darin, ob die vermeintliche Plagiatorin das “Original” gekannt hat oder nicht. Sogar, wenn ein Song 1:1 einem Bestehenden gleicht, gilt dieser nicht als Plagiat, wenn die Ähnlichkeit auf reinem Zufall beruht. George Harrisons “My Sweet Lord” war eine offensichtliche Kopie des Chiffons-Hits “He's so fine”, aber Harrison beteuerte, er habe das Lied nie gehört. Das Chiffons-Lied war allerdings ein großer Hit und der Richter hielt es schlicht für wahrscheinlicher, dass Harrison den Song unbewusst gehört und ebenso unbewusst neu erschaffen habe – Harrison musste zahlen. Anders ein früherer Ed-Sheeran-Fall: Sami Chokri und Ross O'Donoghue klagten, ein Teil des Mega-Hits “Shape of You” ähnele ihrem “Oh Why”. Hier jedoch argumentierte der Richter umgekehrt: Zwar ähnelten sich gewisse Passagen der beiden Titel. Doch sei es eher nicht anzunehmen, dass Sheeran sie aus “Oh Why”, abgezwackt habe, weil das Lied schlicht zu unbekannt sei. Die Kläger gingen leer aus.
Man benötigt keine Professur um zu erkennen, dass diese Regelung problematisch ist. Sie führt zu einer Welt, in der die Interessen etablierter, ja sogar längst verstorbener Künstler schwerer wiegen als die einer neuen Generation. Sie impliziert geradezu, dass Stars sich das Recht verdient haben, bei dem Werk unbekannter Kollegen frei zu bedienen, während letztere jede Note sorgfältig prüfen müssen. Davon abgesehen hat sich die Musikwelt seit dem Harrison-Urteil radikal gewandelt. Da Radio und Fernsehen an Boden verlieren, werden in Zukunft vor allem Streaming-Zahlen als Indikator für die Bekanntheit eines Songs hinzugezogen werden. Doch ab wievielen Streams kann ein Song tatsächlich als so groß erachtet werden, dass die Vermutung nahe liegt, jeder habe ihn zumindest einmal gehört?
Vielleicht ist es endgültig an der Zeit, die Kriterien des Urheberrechts zu überdenken.
Denn während sich Musikologen über melodische Bögen und die Einzigartigkeit von Harmoniefolgen streiten, wird Ähnlichkeit durch neue technologische Tools komplett umdefiniert. Streaming-Dienstleister (wie Spotify und Apple Music) waren von Anfang an auf Empfehlungs-Algorithmen angewiesen, um Kunden langfristig an sich zu binden. Ob Edward Townsend oder Ed Sheeran den Tantiemen-Scheck bekommt, ist für sie unerheblich. Was zählt ist die Zeit, die Nutzer bei ihnen verbringen und die monatliche Gebühr, die dabei fällig wird. Das beste Nutzer-Erlebnis besteht in einer Playlist, in der die Hörerin keinen Song skippt, weil jeder ihren Geschmack nahezu perfekt bedient. Kurioserweise spielen viele der Kriterien, die derzeit vor Gericht entscheidend für Triumph oder Verlust sind, hier kaum eine Rolle. Wichtig sind Gefühl, Stimmung, Sound, Groove und Rhythmus, Szene-Zugehörigkeit – all das, was die verblüffende Ähnlichkeit zwischen “Thinking about you” und “Let's Get it On” ausmacht.
“Das Urheberrecht besagt: Das was einen Song originell macht, ist seine Originalität. Kein Wunder, dass es in den letzten 100 Jahren unzählige heftig umstrittene Fälle gegeben hat.”
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses Ziel umzusetzen. Eine der interessantesten neuen Varianten besteht darin, einen Track in ein Bild umzuwandeln, das weitaus tiefer ist als eine reine Wellenform, und dieses anschließend mit den Bildern anderer Kompositionen zu vergleichen. Dabei macht man sich extrem fortgeschrittene Bildanalyseverfahren zunutze und fördert Muster zutage, die sich einer traditionellen Auswertung entziehen. Vor allem aber funktionieren die Empfehlungs-Algorithmen dank brutaler Rechenleistung. Sie arbeiten mit riesigen Datenmengen über eine extrem lange Liste von Eigenschafts-Tags, mit denen jeder Track versehen wird. Hinzu kommen Korrelationen aus den sozialen Medien: Tauchen zwei Songs auf twitter häufig in den selben Netzwerken auf, gelten sie als stärker miteinander verwandt. Auch Sprach- und Kulturkreise können über entsprechende statistische Verfahren miteinbezogen werden. So entstehen gigantische Bäume der Ähnlichkeit und Fremdheit.
All das mag angesichts der Emotionalität des Produkts Musik recht befremdlich wirken. Doch die Ergebnisse geben den Erfindern recht: Die automatisierten Empfehlungen sind weitestgehend kuratierten Playlists menschlicher Experten ebenbürtig oder sogar überlegen. Und gegenüber traditionellen Ansätzen haben diese Methoden einen weiteren Vorteil: Sie sind weitaus objektiver und lassen überprüfbare Urteile zu. Vor Gericht werden sie gewiss nicht so bald zum Einsatz kommen. Das muss aber vielleicht auch gar nicht sein. Alleine schon, wenn es dank ihnen gelingt, die Kriterien für Originalität zu erweitern und auf eine breitere Basis zu stellen, wäre all denen geholfen, die in ihrer Kunst nach etwas Persönlichem suchen, statt sich lediglich bei den Hits der Stunde zu bedienen. Nur für Ed Sheeran könnte die Luft dünn werden.