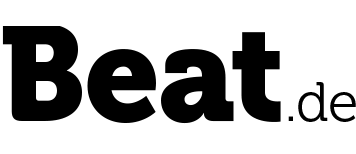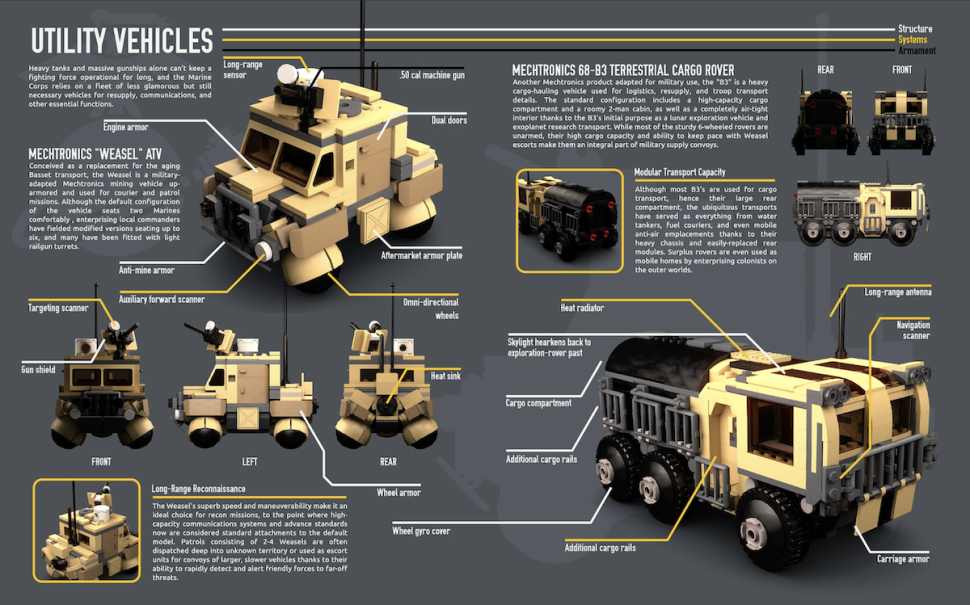Dass künstliche Intelligenz im Konflikt mit dem Urheberrecht steht, stand von Anfang an fest. Doch während Politik und Gerichte noch über die Konsequenzen sinnieren, ist die Technologie dem Geschehen bereits einige Schritte voraus.
Was, wenn sich mit KI Musik auf Vorrat produzieren ließe, um in der Zukunft potentielle menschliche Urheber verklagen zu können?
Cameron Gorham, der unter dem Namen Venus Theorie schwebenden Ambient produziert und sein Einkommen vor allem als Sound Designer bestreitet, stieß kürzlich auf eine eklatante Lücke im Youtube-System. Grundsätzlich erlaubt es die Plattform, Inhalte vor unerlaubter Nutzung zu schützen und gegebenenfalls Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu müssen Rechteinhaber nur ihre Musik über einen Dienst namens „Content ID” anmelden.
Soweit, so gut, so scheinbar einfach. In der Praxis jedoch ergeben sich aus Content ID eine Vielzahl Konflikte. Die schwerwiegendsten davon könnten sich schon bald als desaströs erweisen.
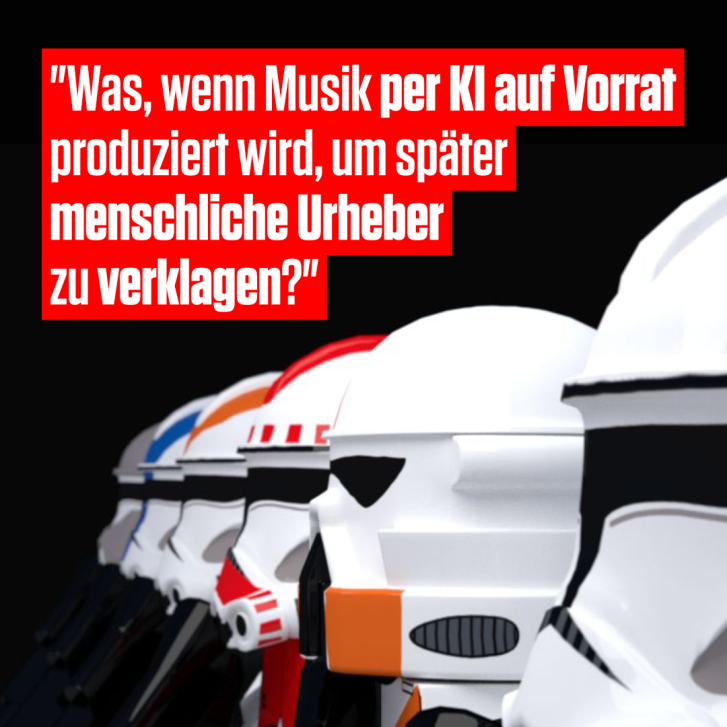
Registrierter Betrug bei YouTube
Zunächst einmal sind sich viele überhaupt nicht der Tatsache bewusst, dass sie ihre Werke auf Content ID anmelden müssen, um einen wirksamen Schutz zu genießen. Die Folge: Dritte können diese Lücke schließen indem sie Produktionen eintragen, die sie überhaupt nicht selbst geschrieben haben, die Einnahmen abschöpfen und sogar die wahren UrheberInnen verklagen. Man sollte meinen, dass dieser Betrug recht einfach zu überführen ist. Dem ist aber nicht so, weil Content ID kein Instrument des Urheberrechts ist, sondern vielmehr andersherum ein Tool, um die Anwendung des Copyrights von der Plattform fernzuhalten. Das wird an der Art erkennbar, wie Youtube mit vermeintlichen Verstößen umgeht.
Zunächst scannt das System, wer die registrierten Inhalte auf Youtube nutzt. Jede nicht explizit genehmigte Verwendung hat sofort eine Sperre des Materials zur Folge. Ein Einspruch ist zwar möglich und die Sperre wieder aufgehoben werden. Nur darf in diesem Fall paradoxerweise der Kläger entscheiden, ob dem Einspruch statt gegeben werden soll. Sobald ein Content Creator drei Mal geklagt hat und abgewiesen wurde wird sein Konto automatisch gesperrt. So wird jeder Versuch, sein Recht einzufordern, zum Risiko.
Geradezu dystopisch wird die Angelegenheit, wenn man KI mit einbezieht. Um die Manipulationsmöglichkeiten auszuloten, beschloss Cameron, eine Anwendung damit zu beauftragen, einen neuen Song auf der Basis eines seiner eigenen Titels zu produzieren, der noch nicht bei Content ID angemeldet war. Der Prompt: Generiere einen Track, der so genau wie möglich wie ein Venus-Theory-Stück klingt, ohne als ein direktes Plagiat erkennbar zu sein.
Die Ergebnisse waren schockierend!
Zum einen war das KI-Stück bemerkenswert gut. Alleine schon damit öffnen sich unzählige Möglichkeiten für Filmproduzenten oder kommerzielle Anbieter, den Sound zu kopieren, den Cameron über viele Jahre hinweg durch Trial-and-Error, unzählige Produktionen und tausende unbezahlter Studiostunden erarbeitet hat, ohne ihn dafür entlohnen zu müssen. Darüber hinaus lassen sich nunmehr endlose Variationen von Venus-Theory-Titeln erzeugen, die anschließend über Content ID unter einem anderen Urheber registriert werden können. Zwar erlauben weder Urheberrecht noch Content ID das Registrieren von Material, das von einer KI generiert wurde. Wie aber soll diese Forderung in der Praxis überprüft werden?
So ist es keineswegs ausgeschlossen, dass Cameron selbst, sobald er neue Musik komponiert und auf Streaming-Dienste hochgeladen hat, als Imitator angeklagt wird. Und das weil sie Musik zu sehr ähneln, die auf dem Nährboden von Venus Theory gewachsen sind.
Auch das Copyright selbst steht unter Beschuss
Im Songwriting wirft die Möglichkeit, Musik im Stile bestehender KünstlerInnen zu verfassen, schwerwiegende Fragen auf. Schon jetzt gehen MusikerInnen die Melodien aus. Der Tech-Anwalt Damien Riehl hat überzeugend dargelegt, dass die Zahl der Noten, die sich in der Pop-Musik sinvoll verwenden lassen, erschreckend klein ist. Jeder, der sich an sein Instrument oder an den Laptop setzt, steht somit vor der Herausforderung, nicht eine der bereits verwendeten Tonabfolgen zu wiederholen.
Oder genauer gesagt: Nach dem Songwriting ist oftmals bereits vor dem Prozess. Das, was uns an unverbrauchten Kombinationsmöglichkeiten noch zur Verfügung steht, wird vor allem durch die übernatürliche Rechenleistung „kreativer Algorithmen” bald aufgebraucht sein. Die Konsequenz: Entweder wir hören alle nur noch Zwölftonmusik oder, wie Riehl etwas plausibler wenngleich kommerziell radikaler vorschlägt, wir nehmen Melodien vom Urheberrecht aus. Der Vorschlag macht Sinn, klingt plausibel und wird von einem Mann gemacht, der ganz offensichtlich ein großer Musikfan ist. Eine Frage aber stellt sich: Was bleibt vom Urheberrecht überhaupt noch übrig?
Die Frage muss Produzenten und Songwriter nicht gleich in die Sinnkrise stürzen. Schließlich befindet sich das Urheberrecht spätestens seit Mitte der 1960er in einer Dauerkrise. Von der Compactcassette über CD und Downloads - ständig mussten Grenzen der Zulässigkeit für das Erstellen von Kopien gezogen werden. Durch diesen Prozess stetigen, aber zunehmend schnelleren Wandels wurde das Copyright zugleich erweitert, präzisiert, in vielen Teilen aber auch eingeschränkt. Ruhe ist jedoch nicht eingekehrt.
Eher im Gegenteil hat sich die Schlagzahl der technischen Erneuerungen, und somit auch die Notwendigkeit einer juristischen Antwort, welche die Interessen aller Beteiligten gleichermaßen berücksichtigt, erhöht. Heute ist ihr Tempo endgültig so atemberaubend, dass jede Regelung bereits bei Verabschiedung veraltet ist.
Ein kurzer Blick auf den Video-Bereich belegt die Dringlichkeit dieses Themas. Fil Henley von der Band Wings of Icarus ist für seine Audio-Analysen bekannt, in denen er fast schon zwanghaft penibel und mit wissenschaftlicher Akribie aufzeigt, dass nahezu alle Stars und Superstars in ihren „Live-Shows” letzten Endes nur noch zum Backing-Track die Lippen bewegen. Darüber hinaus interessieren ihn auch die Möglichkeiten, wie manche Kanäle online mit falschen Realitäten, Identitäten und Talenten spielen.
Als Beispiel führt Henley verschiedene Videos vor, in denen auf den ersten Blick junge Gitaristinnen beim Spielen zu sehen sind. Alle Clips aber zeigen ausnahmslos AI-generierte Bilder. Auf der einfachsten Stufe sind noch recht eindeutig Artefakte erkennbar, verschwinden Elemente und tauchen unvermittelt wieder auf, verschwimmen Finger und Haare gelegentlich. Insgesamt aber ist die Qualität bemerkenswert hoch. In der technisch am besten umgesetzten Variante ist der Betrug ist nur noch für das geübte Auge erkennbar.
Verbrechen der Zukunft
Man könnte in gewisser Weise sagen: Diese Techniken machen es möglich, die Rechte der Kreativen in der Zukunft zu verletzen. Denn für viele der genannten Situationen gibt es im bestehenden Recht noch keine Präzedenzfälle und somit keine Handhabung. Erschwert wird die Lage noch dadurch, dass verschiedene Länder nicht nur unterschiedliche Verständnisse des Copyrights haben, sondern darüber hinaus den gleichen Sachverhalt unterschiedlich bewerten. So ist es beispielsweise in den meisten Ländern nicht oder nur innerhalb sehr enger Grenzen legal, die Gesichtszüge, das Ebenbild oder die Stimme einer Person ohne deren ausdrücklicher Erlaubnis zu verwenden.
Das musste der kanadische Rapper Drake erkennen, als er in einem seiner Tracks per AI mit Tupac Shakur und Snoop Dog kollaborierte. Die Erben Tupacs verweigerten empört ihre Zustimmung und der Song musste zurückgezogen werden. Doch in Australien beispielsweise sind diese Einschränkungen weitaus weniger streng, was Fragen darüber aufwirft, wie bereits das heutige gültige Recht international durchgesetzt werden kann. [5] Außerdem sind Stimm- und Gesichts-Ähnlichkeiten auch bei Menschen möglich und kaum vermeidbar – wo ist hier die Grenze zu ziehen?
Zweifelsohne hat sich nicht jede dunkle Zukunftsfantasie bewahrheitet. Doch muss man nicht Skynet heraufbeschwören, um zu erkennen, wie weit die computerunterstütze Produktion von Musik bereits fortgeschritten ist. In einem gutgelaunten Video zeigt der Produzent Henry Clarke, wie er nahezu ohne Eigenbeteiligung in kürzester Zeit zu einem Song kommt, der bemerkenswert hörenswert ist: Zunächst bittet er ChatGPT, ihm einen Text und eine Akkordfolge zu schreiben.
„Neue Techniken machen es möglich, die Rechte der Kreativen in der Zukunft zu verletzen. Denn für viele aktuelle Probleme gibt es im bestehenden Recht noch keine Präzedenzfälle.“
Anschließend kopiert er diese Informationen in den Editor der Anwendung „Band in a Box”. Diese erstellt nun dazu passend ein komplettes Arrangement, das dank der hervorragenden Samples ziemlich organisch anmutet. Alles, was Clarke nun noch tun muss, ist, eine Melodie einzusingen und ein wenig an dem Arrangement zu feilen – wobei auch diese Aspekte schon bald keiner menschlichen Beteiligung mehr bedürfen.
Der Unternehmer, IT-Experte und Musiker Ravin Mehta hat gerade das Label Made by Robots gegründet, bei dem KI eine zentrale Rolle spielt, und betont dass es nur einen einzigen fairen Umgang mit künstlicher Intelligenz im Kreativbereich geben kann: „Um für eine kommerzielle Nutzung auf der sicheren Seite zu sein, musst du die Daten selbst erzeugen oder lizensieren.” Der Erwerb eines bereits trainierten Modells verbiete sich, da hierbei zwangsläufig geschütztes Material verwendet werde.
„Wir arbeiten mit einer Daten-Pipeline, die an jedem musikalischen und nicht-ganz-so-musikalischen Material geschult werden kann, um etwas Neues zu erzeugen”, so Mehta, „Das können zum Beispiel die Tech-House-Tracks sein, die wir auf dem Label veröffentlichen oder auch die Musik, die wir aus den Daten generieren, die wir von Pflanzensensoren erhalten, mit denen in der Folge KI-Modelle trainiert werden.”
Es wird ganz offensichtlich einer neuen, politisch und rechtlich untermauerten Ethik bedürfen, diese Situation zu meistern. Bis es dazu kommt, wird viel Zeit vergehen – wieviel haben Kreative noch?