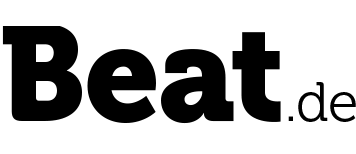Auch die Charts sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Seitdem Streaming zur dominanten Konsumform geworden ist, wirken die Hitparaden wie ein exklusiver Club, in den nur wenige Mega-Stars eingeladen sind. Manche halten das für bedenklich. Andere plädieren für die endgültige Abschaffung der Charts. Irgendwie macht beides Sinn.

Millionen von Hörern warten jedes Jahr darauf, dass man endlich wieder auf Schritt und Tritt von „Last Christmas“ verfolgt wird. Gleichermaßen innig geliebt und abgrundtief gehasst, versüßt und ruiniert diese genial-generische Feiertagsschnulze uns seit 1984 den Dezember. Für George Michael jedoch, der den Song nahezu im Alleingang produzierte und jedes einzelne Instrument darauf eigenhändig einspielte, stellte der Track zu Lebzeiten einen kleinen Fleck auf der ansonsten nahezu perfekten Charts-Historie seiner Band Wham! dar. Denn: Der Song erreichte in Großbritannien nie die Spitzenposition in den Charts. Seinerzeit trat die Single gegen die Benefiz-Veröffentlichung „Do they know it's Christmas?“ an (bei der Michael nebenbei auch mitsang) und verlor. Posthum immerhin hat das Lied nun einen späten Triumph erfahren. 2020 war „Last Christmas“ der erfolgreichste Song der Vorweihnachtszeit und ergatterte somit 36 Jahre nach Erstveröffentlichung die Pole-Position. Späte Gerechtigkeit? Nicht aus der Sicht von Paul Sinclaire, dem Chefredakteur des englischen Online-Magazins „Super Deluxe Edition“. Für ihn steht fest, dass der Erfolg lediglich auf eine fehlgeleitete Einbindung von Streamingzahlen in die Verkaufscharts zurückzuführen ist. Vergleichen ließen sich die Hitparaden aus 1984 und 2020 keineswegs, hier werde vielmehr Geschichte umgeschrieben: „Die Regeln, die aktuell die Singles-Charts bestimmen, erlauben es Leuten, die keine physischen Tonträger oder Downloads kaufen und nicht einen Penny für Streaming ausgeben, eine signifikante Zahl an „Verkäufen“ generieren.“
Man kann Sinclaire's Meinung teilen oder als Ewiggestrigkeit abtun. Fest steht, dass die Art, wie wir zählen, die Charts – und damit unser übliches Verständnis davon, was ein Hit und wer ein Star ist – maßgeblich beeinflusst. Gerade noch stellte die Vertretung der amerikanischen Musikindustrie, RIAA, ihre Hitparaden-Regeln um. Ab sofort können Sondereditionen und Vorbestellungen eines Albums nur unter bestimmten Bedingungen und erst dann als offizielle Verkäufe verbucht werden, wenn das Produkt auch wirklich an den Kunden zugestellt wurde. Hintergrund dieser Regel: Immer mehr MusikerInnen versuchen ihre Verkaufszahlen in der ersten Woche aufzuplustern, indem sie treue Fans mit Spezialausgaben des aktuellen Albums ködern, die aber erst Monate später produziert werden. Vor den Veränderungen war Taylor Swifts „Folklore“ noch mit fast einer Million verkauften Exemplaren, darunter extrem viele Vorbestellungen, an die Spitze der (Jahres)Charts gestürmt. Nach Umsetzung der neuen Richtlinie standen die Verkaufzahlen für ihr aktuelles Werk „Evermore“ nur noch bei knapp über 300.000. In England, wo andere Regeln gelten, gelang den ewigen Jungspund Paul McCartney hingegen mit seinem komplett zu Hause in Quarantäne eingespielten „Mc Cartney III“, in seinem achten Lebensjahrzehnt der Sprung an die UK-Charts-Spitze. Sir Paul hatte sich eine Kampagne einfallen lassen, bei der es so viele Vinyl-Farbvarianten und CD-Sonderausgaben gab, dass sogar fanatische Fans irgendwann den Überblick verloren und einfach nur noch auf „kaufen“ klickten. All das freilich gab es bereits seit den frühesten Tagen der Musikbranche und trotz aller berechtigten Kritik hat niemand ernsthaft erwägt, die Charts deswegen abzuschaffen. Warum sollte es diesmal anders sein? Die Antwort darauf zeigt auf, wie drastisch sich in den letzten zwei Jahrzehnten unsere Art Musik zu konsumieren verändert hat – und wie unmöglich es sich erweist, neue Gegebenheiten in alte, teilweise lieb gewonnene Schläuche zu pressen.
Willkürliche Umwandlungen
Wenn Paul Sinclaire hingegen bemängelt, dass die neuen Charts nicht mit denen seiner Jugend zu vergleichen sind, hat er nur teilweise recht. In den 80ern und 90ern wurden zwar in den meisten Ländern tatsächlich ausschließlich physische Verkäufe für einen Platz in den Hitparaden gewertet. In den USA aber, dem mit Abstand größten Tonträgermarkt der Welt, flossen schon immer auch die Radio-Einsätze in die Wertung der Billboard 100 mit ein – ein Ansatz, der das aktuelle Streaming-Modell teilweise vorwegnimmt. Das machte Sinn in einem derart riesigen Land mit radikalem Highway-Tempolimit, in dem das Radio auf langen Autofahrten zu einem Wegbegleiter und Freund wurde. Doch auch die USA wurden Anfang des neuen Jahrtausends zum Umdenken gezwungen. Die CD-Verkaufszahlen, ohnehin schon durch Downloads und Torrents arg beeinträchtigt, fielen ins Bodenlose. Weniger denn je reflektierten diese Daten noch die Hörgewohnheiten der aktuellen Generation. Die Charts waren dabei zu verkalken und sich von den realen Hörgewohnheiten abzunabeln. Weltweit waren die Verbände gefordert, die Berechnungen so umzustellen, dass ein Ausgleich zwischen Sales und Streaming entstand. Die Lösung: Ein gewisser Teil der Streams wurde schlicht in Verkäufe umgewandelt. Im UK ergeben heute 100 Streams von zahlenden Mitgliedern oder 600 Streams von nichtzahlenden Mitgliedern einen Verkauf. In den USA addieren sich 1250 Premium-Streams zu einem physischen Album, beziehungsweise 3750 Non-Premium Streams (darunter auch Youtube). In Deutschland werden für die offiziellen Charts ausschließlich die Streams von Premium-Mitgliedern gewertet, die genaue Umrechnungsrate bleibt unter Verschluss.
Willkürlich oder nicht, der Ansatz hat sich bis heute gehalten – mit spürbaren Folgen. Es war zu erwarten, dass aus der neuen Methodik eine Verschiebung resultieren würde. In Wahrheit aber gleicht das Ergebnis eher einem Erdrutsch. Denn während die Industrie noch Mitte der 00er Jahre fürchtete, sie sei nicht mehr in der Lage, neue Superstars zu erzeugen, so droht nun das genaue Gegenteil: Seit Jahren werden Charts und Medien vollkommen von wenigen Mega-Künstlern beherrscht. Als 2017 das neue Ed Sheeran-Album „÷“ erschien, standen plötzlich alle zwölf Tracks in den britischen Top 20. Zu einem späteren Zeitpunkt landeten sogar 16 seiner Titel in den Charts. Justin Bieber hatte siebzehn Titel gleichzeitig in den Billboard 100, The Weeknd und Post Malone 18. Der ungekrönte König des Streamings aber ist Drake. Gleich 27 seiner Tracks standen einmal gleichzeitig in den Singles-Charts. Überhaupt definiert der kanadische Rapper bereits seit Jahren die Grenzen des Möglichen neu mit einer Liste an Rekorden, die ihresgleichen sucht. Dabei sind seine originären Albumverkäufe bereits seit Jahren ebenso rückläufig wie die nahezu aller anderen Künstler auch. Sogar „Scorpion“, das seinerzeit als Magnum Opus präsentiert wurde, verkaufte sich in den USA in der ersten Woche lediglich 160.000 Mal – und somit gerade einmal halb so oft wie das vorher genannte „Evermore“ von Taylor Swift. All das aber macht er mit geradezu irrwitzigen Streaming-Zahlen mehr als wett. Was Drake verstanden hat, ist, dass die Breite des Katalogs die wahre Macht eines Künstlers darstellt. Über 200 seiner Songs landeten insgesamt in den amerikanischen Charts, alle seine Alben, Mixtapes und Playlists sind bis zum Bersten mit Material gefüllt. Es ist ein eigener Kosmos, den er sich geschaffen hat und mit dem man, wenn man möchte, die musikalischen Bedürfnisse eines kompletten Tags befriedigen kann.
Boi-1der, einer von Drakes Lieblingsproduzenten, hat auf Kritik an dieser Einseitigkeit der Charts erwidert, man solle den Stars ihren Erfolg gönnen: „Wenn 16 Songs von Ed Sheeran riesige Erfolge feiern, dann ist das eben so. Ed Sheeran trägt nicht die Schuld daran, dass jeder Ed Sheeran liebt.“ Das aber geht am Kern der Sache vorbei. Denn so, wie Streaming aktuell genutzt wird, beweist die Alleinregentschaft der Superstars durchaus nicht, dass jeder sie liebt. Zum einen entscheiden sich Viele für eine Playlist als Hintergrundmusik für ihren Arbeitsalltag. Diese läuft von vorne bis hinten durch und generiert so für alle enthaltenen Stücke zählbare Streams. Kann dieser passive Konsum wirklich in dieselbe Liste einfließen, in der aufwendige und teure Vinylpressungen enthalten sind? Und wenn Millionen Ed-Sheeran-Fans sich in der ersten Woche immer und immer wieder das neue Album anhören, sind damit dann automatisch alle enthaltenen Songs „Singles“? Und vor allem: Spiegelt dieses Hören wirklich „Popularität“ wieder, also eine wahre Wertschätzung? Auch Radio und Musikfernsehen hatten in den 90ern die unsympathische Gewohnheit, bestimmte Songs penetrant immer und immer wieder zu spielen, mit der Folge, dass man sie eher gehasst denn geliebt habt. Was wir wissen, ist dies: Irgendwo auf der Welt laufen diese Alben, genau wie in vielen Büros früher, von Morgens bis Feierabend, wenn das Radio lief. Die emotionale Beteiligung der Hörerin bleibt dabei vollkommen ungewiss.
Die Vielfalt leidet
Natürlich gilt: Im alten System gab es viele „Fehlkäufe“: Alben, die einem schon bald peinlich wurden, Singles, die man nur ein oder zwei Mal höre, günstig eingekaufte Angebote, die ungespielt in einem Karton landeten. Seinerzeit wurde somit zweifelsohne der monetären Wertschöpfung zu viel Bedeutung beigemessen. Das Problem ist, dass die Charts, wie das Rolling-Stone-Magazin es formuliert hat, wichtig sind, egal ob man sich nun für sie interessiert oder nicht. Denn solange die Charts noch als das maßgebliche Erfolgsmaß gehandelt werden, bestimmen sie für die Mehrzahl der Künstler über ihre Karriere entscheidend mit. So gesehen ist es bedenklich, dass unter den modernen Regularien vor allem die musikalische Vielfalt gelitten hat. Die Zahl neuer Songs in den wöchentlichen Charts ist seit Jahren rückläufig, manche Songs halten sich gefühlte Ewigkeiten in den oberen Bereichen, die stilistische Diversität so mancher 90er-Jahre-Hitparaden ist einer Art Monokultur gewichen. Das hat Methode: Belohnt werden Musiker, deren Fans nahezu ausschließlich ihre Musik hören, statt nach spannender neuer Musik zu forschen. Es ist eine seltsame Betonung der Bequemlichkeit gegenüber Entdeckergeist und einer Aufgeschlossenheit gegenüber dem Neuen. Zu allem Überdruss bestätigt sich das System über seine gnadenlos rationalen Algorithmen konstant selbst: Die Songs in den beliebtesten Playlists führen zu den höchsten Zugriffsraten und landen somit in den Charts.
Die Songs, die hoch in den Charts stehen, landen wiederum in den beliebtesten Playlists. Um als Newcomerin in den beliebtesten Playlists zu landen wiederum braucht es das Budget eines schlagkräftigen, finanzstarken Labels. Die schöne neue, demokratischere Welt sieht anders aus.
Wenn Manche nun fordern, die Charts einfach komplett abzuschaffen, klingt das durchaus plausibel. Denn streng genommen braucht die Hitparade nun wirklich nicht gerettet werden. Über das Vorschlagssystem von Amazon und Spotify beispielsweise lassen sich mindestens genau so gute neue Acts finden wie über die traditionellen Singles-Charts. Wovon man sich aber wohl verabschieden muss, ist die Vorstellung, die Charts bildeten etwas ab, aus dem sich wirklich aussagefähige Rückschlüsse über die Bedeutung einer Künstlerin treffen ließen. Vielmehr zersplittert auch dieser Teil unserer Welt in eine Vielzahl kleiner Dateninseln, die für eine kleine, aber sehr bestimmte Demographik präzise zutreffen, darüber hinaus aber rein gar nichts bedeuten. Auf manchen dieser Inseln werden noch physische CDs verkauft und Vinyl-LPs zelebriert. In anderen ist „Last Christmas“ endlich und unbestreitbar die Nummer 1, die es immer zu sein verdiente.