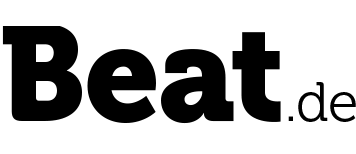Indie-Dance nennt Felix De Laet seinen Sound, mit dem er über Nacht die Charts und Festivalbühnen erobert hat. Sein Debüt-Album „Less is More“ wird nun zur Bewährungsprobe. Ist De Laet nur eine weitere Sternschnuppe am EDM-Himmel – oder hat er das Zeug zu mehr?

Popstars sind nicht mehr das, was sie einmal waren. In den 80ern konnte man sich noch auf die Larger-than-Life-Qualitäten der Hit-Garanten verlassen. Boy George: exzentrisch! Madonna: eklektisch! Prince: enigmatisch! Michael Jackson: jenseits aller Kategorien! Felix De Laet hingegen mutet eher so glamourös wie ein Roadie dieser Legenden an, wie der nette Junge, der die Keyboards und Sampler einstöpselt, aber dann eiligst von der Bühne verschwindet, wenn das Konzert beginnt. Von ihm darf man weder eine eigene Kleidungslinie noch einen exklusiven Duft erwarten. Und wenn er in den vergangenen drei Jahren ein Image von sich selbst geschaffen hat, dann das, kein Image zu haben. Im Interview erweist sich De Laet zudem als freundlicher, offener und komplett unkomplizierter Gesprächspartner, dem Allüren fremd sind und dem Sätze wie „Du musst die Musik machen, die dir Spaß macht – nicht die, die man von dir erwartet“ noch ohne professionelle Gleichgültigkeit über die Lippen kommen. So manchem mag das ein wenig zu bodenständig und unglamourös sein, doch eines hat De Laet den großen Vorbildern voraus: Ihm gehört die Zukunft.
Noch immer kratzt sich der junge Belgier am Kopf, wenn er solche Sätze hört. Oder, wenn ihn Fans auf der Straße ansprechen. Oder, wenn er wieder einmal vor vielen Zehntausenden Tänzern auftritt. Denn sein Aufstieg vom Schlafzimmerproduzenten zu einer der Galionsfiguren der aktuellen Dance-Szene hat sich verdammt schnell vollzogen. Nachdem er einige Jahre Klavierunterricht absolviert hat, entdeckt De Laet als 12-13-Jähriger mit seinen Klassenkameraden aus dem Internat House und fängt wortwörtlich über Nacht Feuer. Beim inzwischen eingestellten „I Love Techno“-Festival ist er von der Kraft der Musik gefesselt sowie von den Fähigkeiten der DJs, die ohne jegliche Special Effects oder Live-Einlagen das Publikum stundenlang zu fesseln wissen. Der Gedanke, dass er selbst einmal an ihrer Stelle stehen könnte, ist im zu diesem Zeitpunkt noch fremd. So ist sein Weg dorthin nahezu zwangsläufig von glücklichen Zufällen gepflastert: „Mein Vater hat mir irgendwann einen alten Computer geschenkt. Darauf war Garageband vorinstalliert. Damit habe ich dann angefangen, Musik zu machen“, erinnert er sich. Schon bald verschickt er unter dem Namen Lost Frequencies Demos seiner Produktionen, darunter ein Track, auf den er besonders stolz ist: einen Remix des Songs „crushcrushcrush“ von Paramore. Genau wie viele andere wird er abgelehnt – bis plötzlich wie aus dem Nichts ein ganz großer Fisch anbeißt.




Rock-Frequenzen
Auch wenn De Laet bereits zu diesem Zeitpunkt gerne die frühen, House-lastigeren Avicii-Produktionen und die ersten Stücke von Afrojack hört: Es ist auffällig für einen Elektronik-Act, wie stark Lost Frequencies von Rockbands und Gitarren-Sounds beeinflusst ist. Neben „crushcrushcrush“, einem smart arrangierten, Metal mit Pop verschmelzenden Crossover-Track, entdeckt er auch den Country-Song „Are You With Me“ von Easton Corbin, den er dezent und mit viel Gefühl zu einem der ganz großen Sommer-Hits von 2015 umdeutet. Die Nähe zum klassischen Songwriting ist zweifelsohne einer der Hauptgründe für seinen Durchbruch, genauso aber die Tatsache, dass er seine Produktionen weniger als Remixe denn als Cover angeht. Dabei werden viele Spuren neu eingespielt, teilweise sogar die Vocals mit anderen Sängern aufgenommen, die Struktur des Materials aufgebrochen, ohne der Musik dabei Gewalt anzutun: „Es ist mir wirklich wichtig, dass ich dem Original treu bleibe. Ich will nicht die Stimmung und Ideen des ursprünglichen Autors verlieren. Vielmehr geht es mir darum, bestimmte Stellen des Lieds hervor zu heben und meine eigenen Vorstellungen hinein zu projizieren. Es ist mir wichtig, mit Respekt vorzugehen und die Quellen meiner eigenen Kreativität offen zu legen.“ Auch wenn die Dauerrrotation im Radio dem Song letzten Endes ein wenig geschadet hat: Bei „Are you with me“ ist ihm das geradezu kongenial gelungen. So stutzt De Laet Corbin's Version radikal zurück, nimmt ihr die Epik, Schwere und Melancholie und schneidet den hymnischen Refrain heraus. Was bleiben sind die Melodie, zart angeschlagene Harmonien und ein unterschwelliges Gefühl der Sehnsucht – einer der seltenen Momente, in denen Mainstreamtauglichkeit und leichtfüßige Kreativität zusammenfallen.
Mit eben diesem Track gelingt dann auch tatsächlich der große Wurf. Der besagte große Fisch ist das Amsterdammer Armada-Label, das den Track schließlich veröffentlicht und ihn weltweit in den Charts ganz nach oben bringt. Parallel dazu wird Lost Frequencies zum Dauergast bei den Sommerfestivals. Das belgische Tomorrowland, ein mehrtägiges Event, für seine völlig überdrehte Bühnenästhetik und sein Aufgebot sämtlicher Szene-Größen bekannt, ist von seinem Auftritt sogar derart angetan, das es ihn bittet, das Programm einer ganzen Bühne unter dem Banner „Lost Frequencies & Friends“ zu kuratieren. Wenig später übernimmt Tomorrowland sogar das Management des Künstlers. Als sich Felix kurz danach vor die Entscheidung gestellt sieht, sein BWL-Studium fortzuführen oder sich Vollzeit der Musik zu widmen, fällt diese somit nicht schwer. Die zweite, ähnlich gestrickte Single „Reality“ folgt bereits kurz darauf und wiederholt den Erfolg des Vorgängers. Schon bald sitzt De Laet jedes Wochenende im Flieger zu einem anderen Fähnchen irgendwo auf der Welt. Dort, hoch über den Wolken, entsteht auch das Material für sein erstes Album. Und dafür lässt er sich, im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, erstaunlich viel Zeit.
Gezwungen zum Glück
In gewisser Weise ist er zu dieser ausgedehnten Produktionsphase gezwungen. Denn auch wenn „Are you with me“ und „Reality“ mit einer eigenen Handschrift zu punkten wissen, ist De Laet zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung noch alles andere als ein fertig ausgebildeter Produzent. Wie er selbst unumwunden zugibt, „war Garageband gerade deswegen so ideal, weil du so einfach loopen und sampeln konntest. Parallel dazu habe ich auf YouTube unzählige Clips angeguckt, um mir selbst das Handwerk beizubringen.“ Wichtiger als das Erreichen von Perfektion ist es ihm, ein ganz bestimmtes Gefühl im Hörer zu erzeugen – und dabei waren die kleinen Fehler und Wackler der frühen Singles durchaus zuträglich. Die Grundzüge dieser Philosophie sind bis heute intakt geblieben, darunter auch die Abwesenheit von teurer Hardware in seinen Stücken sowie die Präferenz für knappe Arrangements, die sich im Albumtitel „Less is More“ niedergeschlagen hat. Nerdige Produktionstipps darf man sich bis heute nicht von ihm erwarten: Den A.N.A. Von Sonic Academy hat er sich schlicht zugelegt, weil er „über Sounds verfügte, die ich noch nicht hatte“, und komplexe Technologie spielt für ihn keine Rolle: „Ganz ehrlich, für mich ist vor allem wichtig, dass mein Studio sauber und hell ist und ich mich darin wohlfühle. Der Rest ergibt sich dann von selbst!“




Was nun aber nicht bedeutet, dass “Less is More” sich einer Lofi-Ästhetik verschrieben hätte. Eher im Gegenteil. Sämtliche Gitarrenparts beispielsweise wurden von Gastmusikern eingespielt und Standard-Sounds aus der Sample-Bank vermeidet De Laet inzwischen gezielt, um einen indivuelleren Sound erzielen zu können. Was seine Produktionen ausmacht, ist ihr warmer, auffällig natürlicher Klang und die Betonung der Stimme: “Der Gesang kann die Geschichte eines Songs noch einmal auf ein ganz neues Level bringen. Deswegen soll die Musik die Vocals auch unterstützen und sie nicht übertrumpfen. Die beiden Ebenen sollten vielmehr zusammen ihre Wirkung entfalten.” Auch zum Thema Loudness-War hat er eine auffällig andere Meinung als die meisten EDM-Kollegen: “So langsam wird das doch ein wenig albern. Inzwischen komponieren viele Leute ihre Musik so sehr, dass sie den ganzen Groove und das Leben der Musik dabei verlieren. Meine Tracks sind im Vergleich dazu deutlich weniger laut, weil ich viele organische Sounds verwende. Auch wenn ich elektronische Musik mache, war mir dieser echte, menschliche Vibe sehr wichtig!” So passt es auch, dass er in seinen Kollaborationen bewusst gänzlich unbekannte Sänger angeheuert hat, mit denen er ohne Zeit- und Gelddruck frei experimentieren konnte und bei der beide Seiten sich kreativ einbringen durften. Auch das mag nicht zum Bild des Popstars als visionärem, egozentrischen Genie entsprechen. Aber vielleicht ist das auch gut so.
Ausbruch aus dem Korsett
Gleichzeitig klingen auf dem Album bereits einige Tendenzen an, die es ihm vielleicht schon bald erlauben dürften, aus dem Korsett des so erkennbaren Indie-Dance-Sounds aus zu brechen. Wer jedenfalls erwartet hat, dass „Less is More“ nur aus endlosen Variationen auf „Are you with Me“ besteht, sieht sich getäuscht. Stattdessen findet sich mit „Funky'n Brussels“ ein wachechter House-Track mit Electro-Bass, Flöten und Trompeten; glänzt „Send her my Love“ mit Dancehall-Einflüssen und schließt das Album mit einem sanft pochenden Chillout-Instrumental namens „What Goes Around Comes Around“. Damit ist „Less is More“, auf dem kein Track das klassische Single-Format sprengt und das trotz seiner Länge von immerhin 51 Minuten erstaunlich hörbar bleibt, eine Pop-Platte im alten Stil, die sich nicht zu ernst nimmt und verschiedenste Einflüsse auf wundersame Weise miteinander verwebt. Wirklich interessant sind auch die Songs - darunter das eröffnende „All or Nothing“ - auf denen die Lost Frequencies-typischen Gitarren-Klänge mit Synthie-Sounds vermählt werden, wie man sie üblicherweise aus Peaktime-Festival-Knallern kennt. Während die Leads in Letzteren jedoch elektrisch zischen und funken, werden sie hier zu sanften Farbtupfern – zu einer fernen Erinnerung an ein intensives Erlebnis. So wird „Less is More“, wenngleich aus einer anderen Perspektive, zu einer aktuellen Variante dessen, was Robert Miles' „Children“ für die Prä-Millenniums-Rave-Generation war: Das Album, das man auflegt, nachdem das Festival vorbei, die Ekstaste durchlebt und das Adrenalin abgeklungen ist.
Man darf mehr in diese Richtung von ihm erwarten, denn längst überarbeitet De Laet seine Songs für nahezu jeden Auftritt um, bastelt Hip-Hop-Versionen in den USA und plant bereits die Deluxe-Version von „Less is More“, auf der jeder Track in Richtung Deep House und Dancefloor geremixt wird. Dass er den Ausnahmekünstler Flume als großes Vorbild erwähnt, gibt zudem Hoffnung darauf, dass Lost Frequencies als Projekt auch in Zukunft noch tiefer gehen und in noch in ganz andere Richtungen expandieren könnte. Die Legenden der Vergangenheit mögen mit ihrer Ästhetik eine ganze Generation geprägt haben. Genau daran arbeitet aber auch Felix De Laet, nur in seinem eigenen Tempo und zu seinen eigenen Bedingungen.
Dieser Artikel ist in unserer Heft-Ausgabe 136 erschienen.
www.facebook.com/LostFrequenciesMusic
2016 | Less is More