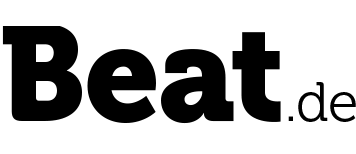Promo-CDs gehören seit Jahrzehnten fest zum Musikgeschäft. Doch das Blatt wendet sich. Zunehmend werden Journalisten nur noch mit Streams und Downloads bemustert, wird die physische Bemusterung zum Ausnahmefall. Die Konsequenzen werden nicht nur für die Presse spürbar sein – und sie könnten sich womöglich sogar als Segen erweisen.

Drogen-Delirien und wilde Exzesse fallen üblicherweise in den Aufgabenbereich der Superstars. Doch auch am Arm der Musikjournalisten hing viele Jahrzehnte lang eine Nadel. Das darin enthaltene Rauschgift wurde kostenlos und direkt aus den Zentralen der Plattenfirmen verabreicht – oder „bemustert“, wie es in der Fachsprache so schön heißt. Als „Promo-Junkie“ hat sich der angesehene Musik-Reporter Randall Roberts bezeichnet und wer einmal, wenn auch nur für kurze Zeit, Rezensionen für die Online- oder Printpresse verfasst hat, weiß, was das bedeutet: Der erhöhte Puls, wenn der Briefträger den Flur betritt; die aufregende Vorstellung ein begehrtes Album vor allen anderen zu besitzen; die Türme von geschenkten CDs und Platten im Arbeitszimmer; der ewige Hunger nach mehr, das blanke Chaos und die ständige Suche nach einem funktionierenden Ordnungssystem. Für manche stellt diese Beschreibung noch immer den Status Quo dar. Denn trotz des Aufkeimens digitaler Distributionswege hat sich die klassische Albumpromotion bemerkenswert lange gehalten. Erst in den letzten Jahren ist der stetige Tropf neuer CDs allmählich versiegt, quellen inzwischen die Inboxen über und nicht mehr die Briefkästen. Die Promo-CD befindet sich auf einem Abschied auf Raten. Und das bedeutet womöglich weitaus mehr, als dass sich Schreiberlinge bald mit Downloads und Streaming-Links begnügen müssen.
Randall selbst hat die Hochphase der Musikindustrie als eine Ära beschrieben, in der sich plötzlich ein wahres Füllhorn über JournalistInnen ergoss. Es war eine Zeit, in welcher der Aufbau einer Plattensammlung als ein ebenso teures wie spannendes Hobby galt, in der der Hunger nach neuen Tonträgern riesig und der wöchentliche Gang zum Plattenladen Teil der Routine war. Die Vorlaufzeiten in der Bemusterung waren ohne den Katalysator des Internets teilweise enorm. Das führte zu faszinierenden Situationen. Denn in einigen Fällen enthielten die Promos gänzlich andere Versionen eines Albums – teilweise mit anderen Track-Reihenfolgen oder mit anderem Artwork, gelegentlich mit zusätzlichen Remixen, die man später nicht mehr über offizielle Kanäle erhalten konnte. Manchmal wurde die Scheibe sogar noch nachträglich überarbeitet, sodass die Promo-CD andere Stücke enthielt oder stark abweichende Mixe. Letzteres beispielsweise bei der bemusterten Fassung des Grunge-Klassikers „Superunknown“ von Soundgarden.
Berge an Musik
Womit ein wunder Punkt der Promo-Ära angesprochen wäre. Tatsächlich war das Bemerkenswerte an der Albumbemusterung, dass sie schlicht kein Ende kannte. Um so mehr Musik man besprach, um so mehr Musik bekam man geschickt, um so unmöglicher wurde die Aufgabe, den Stapel an Promos abzuarbeiten und wieder bei null anzukommen. Selbst der passionierteste Sammler kam da nicht mehr hinterher. So hoch wuchsen die Berge heran, dass sich Viele keinen Rat mehr wussten, und sie schlicht im Sperrmüll deponierten. Andere wiederum nutzten die angehäuften Reichtümer gezielt, um ihr eigenes Einkommen aufzubessern. Der Gebrauchtmarkt für Promos sei das schmutzige kleine Geheimnis der Branche gewesen, so Roberts, und wer einen Journalisten darauf anspreche, erhalte im Gegenzug einen Blick, als habe man sich nach dessen Pornosammlung erkundigt. Unterdessen entwickelte sich im offenen Geheimen ein Schwarzmarkt, auf dem schon kurz nach Erscheinen einer neuen Veröffentlichung die meisten aktuellen Alben mit deutlichem Rabatt feilgeboten wurden.
Die Industrie war sogar dermaßen von diesem Vorgehen eingeschüchtert, dass sie jede Promo-CD mit dem drohenden Warnhinweis versah, der Silberling sei „ausschließlich zu Promo-Zwecken“ zu verwenden und jeder Weiterverkauf strafbar. Solange das System noch funktionierte und am Ende unter dem Strich eine satte schwarze Zahl stand, wurde jedoch nicht ernsthaft kontrolliert. So klagte der Mediengigant Universal erst 2011 gegen die vermeintlich illegale Veräußerung bemusterter Tonträger und berief sich dabei darauf, die CDs seien auf immer und ewig Eigentum der Plattenfirmen. Damit allerdings wäre sogar das Entsorgen der Promos über die Mülltonne strafbar. Das Gericht schien angesichts dieser absurden Argumentation streckenweise fast schon amüsiert und folgte ihr vernünftigerweise nicht. Doch fällt der Triumph eher mau aus. Denn während sich die Majors noch auf Nebenschauplätzen mit kleinen Sticheleien die eigentlich doch knappe Zeit vertreiben, ist in der Medienlandschaft längst in eine ganz neue Zeitrechnung angebrochen.
Einfacher und billiger
Denn die Bemusterung findet heute im Wesentlichen digital statt. Das hat sie nicht nur einfacher, sondern vor allem auch billiger gemacht, weswegen es sich immer mehr Künstler endlich leisten können, ihre aktuelle Veröffentlichung mit einer Kampagne zu unterstützen. So haben sich gerade in den letzten drei Jahren die Schleusen geöffnet. Die Flut an Musik, die dabei auf die Fachpresse einströmt, lässt sich mit konventionellen Mitteln nicht mehr in sinnvolle Bahnen lenken. Alleine in meinem digitalen Posteingang landen täglich 30-40 neue Veröffentlichungen, was im Monat über 1000 und auf Jahresbasis knapp 12000 Promos macht. Parallel dazu ist der Strom an physischen CDs praktisch versiegt, haben sogar renommierte Agenturen die Bemusterung per Post eingestellt. Das wird einigen nicht schmecken, doch war die Entwicklung längst überfällig. Denn digitale Promos haben für die meisten Publikationen deutliche Vorteile: Sie lassen sich weitaus einfacher unter den Autoren zirkulieren, was vor allem dann von Vorteil ist, wenn die Belegschaft, wie heute längst üblich, überall auf der Erde verstreut ist. Außerdem müssen digitale Promos nicht mehr gerippt werden, stehen sofort auf mobilen Endgeräten zur Verfügung und stehen dem physischen Tonträger in Sachen Audioqualität in vielen Fällen um nichts mehr nach. Abgesehen von Ausnahmen wie der Klassik- und Jazz-Szene, in denen teilweise noch andere Gesetze gelten und sich Journalistinnen oftmals digitalen Promos schlicht verweigern, ist so teilweise die leicht paradoxe Situation entstanden, dass manche Künstler durchaus gerne einem Magazin unter hohem Kostenaufwand Original-Alben zukommen lassen würden, diese das aber ablehnen. Wenn überhaupt werden physische Medien nur nach einer Absprache mit der Chefredaktion erlaubt – man muss förmlich darum betteln, einem Journalisten sein Album als CD oder LP schicken zu dürfen.
Man darf sich mit einiger Berechtigung fragen, was einen die Sorgen der Autorinnen überhaupt angehen. Doch spiegelt die aktuelle Promopolitik nicht nur die Krise des Musikjournalismus, sondern verschärft sie sogar noch. Zum einen sind Rezensionen längst eine Dienstleistung, die weitestgehend ihre ursprüngliche Berechtigung verloren hat. Zwar gibt es immer noch eine große Zahl an Magazinen, die sich vornehmlich über ihre Alben- und Singlebesprechungen definieren. Und tatsächlich werden diese Texte auch weiterhin gelesen. Doch dienen sie nicht mehr als Grundlage für Kaufentscheidungen. Vielmehr ist die Kritik, einschließlich der damit verknüpften User-Kommentare, nur ein weiterer Medieninhalt unter vielen, der konsumiert und danach weggeklickt wird. Im direkten Vergleich erweisen sich die Facebook-Auftritte der Künstler als ein deutlich effizienterer Verkaufs-Kanal. Dank unglaublich effizienter Analyse-Tools kennt niemand die Wünsche und Bedürfnisse der eigenen Fans besser als die Musikerin selbst und sie muss sich außerdem in ihrem Territorium nicht mit kritischen Tönen oder ablenkenden Details auseinandersetzen. Im direkten Vergleich ist die Kosten/Nutzenrechnung der Pressebemusterung für Künstler und Labels weitaus schwieriger geworden und kann es kaum verwundern, dass sich für eine weitestgehend wertlos gewordene Medienlandschaft die digitale Promo, als nahezu kostenloses PR-Instrument, durchsetzt.
Abschied vom Thron
Doch sind die Konsequenzen weitaus tief greifender. Der ehemalige Chefredakteur von Spin und Village Voice, Eric Weisbard, hat das Dilemma folgendermaßen umschrieben: „Die Autorität des Kritikers bestand früher einmal darin, dass er direkten Zugang zu den Platten hatte. Das hat es ihm erlaubt, sich ein Urteil zu bilden, das über das eines Normalsterblichen weit hinausging. Ein gewichtiger Teil des eigenen Wissens basierte schlicht darauf, auf eine ständig wachsende Bibliothek zurückgreifen zu können.“ Eben diese Autorität werde nun durch die Konkurrenz von Streaming-Anbietern und BitTorrent-Seiten unterminiert. Der Kritiker sitze schlicht nicht mehr auf seinem Thron, so Weisbard: „Man könnte sogar behaupten: Wenn du dich darauf verlässt, was in deiner Mailbox oder deinem Briefkasten landet, ist dein Zugang zu neuer Musik eingeschränkter, als wenn du dich über die anderen Kanäle informierst. Deine Post ist dem Netz unterlegen. Und das verändert alles.“ Ein Teilnehmer an einer Diskussion auf der Seite plattentest.de hat das recht trefflich auf den Punkt gebracht: „Es erhalten nur die Alben Werbung, für die die Labels es gerne möchten. Dadurch lässt man sich doch die Themen von der Plattenindustrie setzen. Und die Bands, die keine Promotion erhalten, fallen hinten rüber. Und je mehr Magazine so verfahren, desto mehr Thmeneinerlei gibt es.“
Letzten Endes aber müssen alle diese Entwicklungen keineswegs nur negative Folgen haben. In erster Linie nämlich beseitigen sie endgültig die letzten Exemplare einer Spezies, die sich viel zu lange gehalten hat: Die des arroganten und selbstverliebten Kritikers, dessen ursprüngliche Liebe zur Musik in eine Gier nach kostenlos bereitgestellten Tonträgern umschlug. Das Ende der Promo-Junkies stellt für die Szene jedenfalls bestimmt keinen Verlust dar. Auf ihren Gräbern wird, so darf man zumindest hoffen, eine neue Generation von Journalistinnen heranwachsen, welche sich nicht mehr auf falsche Großzügigkeit der Plattenfirmen verlassen müssen, sondern sich ihre eigenen, weitaus spannenderen Pfade durch das Gestrüpp der aktuellen Musiklandschaft bahnen. Letzten Endes kämen sie damit wieder einem Ideal nahe, das wir schon lange verloren geglaubt zu haben schienen: Dem Hörer, der über die Musik schreibt, die ihn wirklich begeistert, ohne Verpflichtungen oder Druck, und der diese Begeisterung mit anderen teilen möchte. Die Promo mag sich tatsächlich auf dem absteigenden Ast befinden – vielleicht ist das ja ein Segen.
Dieser Artikel ist in unserer Heft-Ausgabe 151 erschienen.