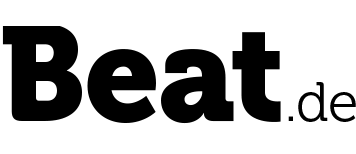Das Virtuelle ist in der Realität angekommen. Hologramme erscheinen heute ganz selbstverständlich bei Konzerten, Computeranimationen gehen auf Tour oder machen Fernsehwerbung. Gierig stürzt sich die Musikindustrie auf die Möglichkeiten der Technologie – doch was sind die Konsequenzen?

Die Auftritte von Hatsune Miku gehören zum spektakulärsten, was die Musikbranche derzeit zu bieten hat. Begleitet von einer perfekt eingespielten Band und eingebettet in einen Strudel aus Special Effects, legt die 16-Jährige eine Performance hin, die zwischen Brett-harten Metal-Passagen und süßlichen Pop-Momenten schwankt. Als sei es Teil der Choreografie, schwenkt das Publikum dazu die Glow Sticks, schreit die Texte mit und wird dabei in einen kollektiven Freudentaumel gestürzt. Man kennt die radikalen Stilbrüche und die Anime-hafte Ästhetik bereits von anderen japanischen Acts wie Baby Metal. Doch lässt Miku selbst diese alt aussehen. Noisey-Autor Drew Millard beschreibt die Erfahrung seines Konzertbesuchs folgendermaßen: „Ich habe mich dabei stets gefühlt, als müsse ich mich gleich übergeben. Aber irgendwie schien genau das die Absicht zu sein. Du fühlst dich, als ob du high bist, ohne dass du irgendwelche Drogen genommen hast.“ Das eigentlich Wahnwitzigste der Performance: Hatsune Miku gibt es gar nicht. Zumindest nicht in physischer Form. Ihr Körper wird auf eine riesige Glaswand projiziert, ihre Stimme entstammt einem Sprachsynthesizer, ihre Bewegungen sind komplett vorprogrammiert. Was heute noch wie eine Vision aus der Zukunft anmutet, könnte schon bald auf der Tagesordnung stehen.
Denn Miku befindet sich in bester Gesellschaft. So erlebt auch Korea gerade einen Boom virtueller Popstars und sind Hologramme längst weltweit gern gesehen Gäste bei vielen Veranstaltungen – von Celine Dion's Elvis-Duett in Las Vegas über den Auftritt des verstorbenen Tupac Shakur beim Coachella-Festival bis hin zum letztjährigen Gig des Hardrockers Ronnie James Dio in Wacken. Während besagte Darbietungen sich zumeist auf einen einzigen Song bei ausgewählten Events beschränkten, begeben sich die aktuellen Projektionen bereits auf ausgedehnte Tourneen. Die vielleicht ambitionierteste bisher: der legendäre Roy Orbison, der im April als animierte Reinkarnation zusammen mit dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra auf Konzertreise durch England ging. Dass die Zahl vergleichbarer Projekte derzeit schlagartig zunimmt, liegt an den stark gesunkenen Kosten der dahinter stehenden Technologie. Als der ehemalige East 17- und Pet Shop Boys-Manager Tom Watkins 2002 Sony die Etablierung eines virtuellen Popstars namens Kukani vorschlug, handelte er sich „das größte NEIN ein, das ich jemals bekommen habe“. [2] Noch fünf Jahre später belief sich die Rechnung für Dion's Begegnung mit dem „King“ – die gerade einmal einen einzigen Song lang war – angeblich auf satte $100.000. Inzwischen hat sich nicht nur die Technologie deutlich verbessert, ist die Hologrammqualität deutlich realistischer geworden. Auch hat sich die Preiskalkulation geradezu auf den Kopf gestellt. In mancher Hinsicht erscheint das Geschäft mit virtuellen Popstars heute als die günstigere und somit lukrativere Option.
Erste Vorstöße
Auch wenn das Geschäft mit den Hologrammen derzeit einen Boom erlebt – gänzlich neu ist es nicht. Der erste Vorstoß in diese Richtung fand bereits Anfang der 80er statt, als sich Kraftwerk nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei Photo-Shootings von ihren berühmten Mannequins vertreten ließen. Die Logik hinter den mechanischen Schaufensterpuppen: Nur Roboter konnten eine dermaßen synthetische Musik geschaffen haben, deren Medium rein elektronisch und bei der das Studio das Instrument ist. Virtualität war bei Kraftwerk genau genommen noch nicht Teil des Konzepts. Die Roboter entwickelten nicht so sehr ein Eigenleben, sondern waren eher Vertreter für fehlende menschliche Präsenz. Bereits einen entscheidenden Schritt weiter ging wenige Jahre später die Cyberpunk-Figur Max Headroom. Ursprünglich Teil der Besetzung eines vollkommen irren Science Fiction-Films für das englische Fernsehen, erhielt Max schließlich seine eigene Fernsehserie, tauchte als Sprecher in dem Art-of-Noise-Klassiker „Paronoimia“ auf, war zu Gast bei David Letterman und führte Interviews mit Musikern wie Sting und David Byrne von den Talking Heads. In seinen Sendungen erschien Max komplett virtuell, ein sich ruckelig bewegender Oberkörper vor einem psychedelisch glitzernden Hintergrund aus geometrischen Figuren. Ein früher Triumph künstlicher Intelligenz? Nicht ganz. In der Realität hätte die Rechenleistung seinerzeit bei Weitem nicht für wahre Virtualität ausgereicht. So schlüpfte der Schauspieler Matt Frewer in einen eng anliegenden Glasfaseranzug, mimte die androiden Gesichtsverzerrungen und sprach die monologisierenden Texte. Lediglich die „Software-Sprünge“ in der Animation und die gelegentlichen Sprach-Glitches wurden nachträglich am PC hinzugefügt.
Max Headroom war kurze Zeit Kult. Es sollte noch über ein Jahrzehnt dauern, bis sich Projekte durchführen ließen, die mehr als nur einen Nischen-Appeal hatten. Bereits 1998 von Blur-Sänger Daman Albarn und Comic-Zeichner Jamie Hewlett gegründet, gelang den Gorillaz 2001 mit ihrem gleichnamigen Debüt-Album und einigen markanten Hit-Singles der Durchbruch. In den Videos tauchten die Musiker ausschließlich als animierte Figuren auf, in ihren ersten Auftritten spielte die Band hinter einer riesigen, als Projektionsfläche dienenden Leinwand und ließ sich als niedliche Vinyl-Figuren verewigen. Waren die ersten Gigs noch eher etwas bizarr und krude, näherte man sich in den folgenden Jahren immer mehr dem Ideal einer überzeugenden virtuellen Performance an. So war es nur konsequent, dass die Gorillaz zu den ersten Acts gehörten, bei denen Hologramme bei den eigenen Konzerten zum Einsatz kamen. Heute denkt man offen darüber nach, die Tools für das Fortleben der Band an nachrückende Musikergenerationen weiter zu vererben und damit als eine Art Computerprogramm ewiges Leben zu erreichen. Auch wenn der Einfluss und die musikalische Qualität der Gorillaz kaum zu überschätzen ist – so richtig überzeugend war das Konzept nie. Zu offensichtlich traten Albarn und Hewitt hinter ihren Comic-Charakteren hervor, zu fassbar blieben sie, zu imperfekt war die Illusion. Dabei hätte es weitaus überzeugendere Vorbilder gegeben. Denn bereits einige Jahre zuvor hatte man in Japan komplett originäre Computer-Figuren entwickelt, die keinen spürbaren Bezug zu irgendwelchen menschlichen Vorbildern mehr aufwiesen.
Das Online-Musikmagazin Pitchfork hat die Geschichte dazu in einem ausführlichen Artikel noch einmal Revue passieren lassen. Sie beginnt mit Kyoko Date, die Anfang der 90er als erster digitaler Popstar von der Talentagentur (!) Horipro entwickelt wurde. Trotz ihres Pionierstatus sowie eines Millioneninvestments seitens Horipro war Date kein großer Erfolg beschieden. Ihr Song „Love Animation“ verpasste die Charts, das Video dafür wirkte eher verkrampft als faszinierend und trotz der endlosen Programmierstunden brauchte die „Sängerin“ noch immer menschliche Unterstützung beim Singen und Reden. Noch schwerer wog hingegen, dass man ganz offensichtlich das Interesse des Publikums falsch eingeschätzt hatte. Nur wenige Wochen nach „Love Animation“ gelang Date's virtueller Konkurrentin Shiori Fujisaki mit der Single „Oshiete Mr. Sky“ gleich im ersten Anlauf ein bescheidener Hit. Dabei war Shiori ironischerweise deutlich weniger aufwendig auf Menschlichkeit optimiert worden, ähnelte in der Anmutung und Animation eher einem Anime-Mädchen. Doch genau das war es offensichtlich, was die Hörer interessierte: eine Figur an der Grenze zwischen humanen Merkmalen und Künstlichkeit – oder schlicht, wie Pitchfork es auf den Punkt bringt, „etwas, was man noch nie vorher gesehen hatte“. Seitdem haben immer wieder neue virtuelle Popstars für kleine Sensationen gesorgt, von dem koreanischen Adam, der immerhin zwei komplette Alben veröffentlichte, zur Date-Nachfolgerin Yuki Terai, deren strahlend weiße Zähne sogar in einer Zahnpastawerbung glänzten. Doch erst mit Hatsune Miku wurde aus dem Trend ein Hype.
Traumhafte Möglichkeiten
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die Musikindustrie ein derart starkes Interesse an Hologrammen und virtuellen Stars zeigt: Sie verlangen keine Gage, sind immer pünktlich, beschweren sich nicht und verpassen keinen Gig. Vor allem in der Post-Avicii-Ära, in der das brutale Ausnutzen junger Künstler zu kommerziellen Zwecken zurecht angeprangert wird, bieten künstlich geschaffene Darbieter geradezu traumhafte Möglichkeiten, ein erfolgreiches Pop-Phänomen ohne schlechtes Gewissen gnadenlos auszuschlachten: Täglich können Auftritte überall auf der Welt bestritten, zeitgleich Performances in den größten Konzerthallen absolviert werden. Bei Sponsoring-Deals und Promo-Events gibt es keine moralischen Bedenken, bei Interviewanfragen keine Engpässe im Kalender. Auch können virtuelle Stars problemlos mit ihrem Publikum wachsen, sich theoretisch sogar in verschiedene Spin-Offs aufspalten, die auf ganz bestimmte Zielgruppen zurechtgeschnitten sind. Auch auf kreativer Ebene öffnen sich durchaus spannende Potenziale. So wurde beispielsweise Hatsune Miku von einem Team entwickelt, das ursprünglich an einem äußerst überzeugenden Sprachsynthesizer arbeitete. Die Ergebnisse der Software klingen nicht nur bestechend organisch. Sie übertreffen zudem in jeglicher Hinsicht die Möglichkeiten des menschlichen Gesangs. Der eigensinnige amerikanische Komponist Noah Creshevsky, der in seinem Werk der irrwitzigen Übersteigerung mechanischer Musikproduktion nachgeht, hat das als Hyperrealität bezeichnet: Texte, die schneller gesungen werden, als sie gehört werden können; Melodiesprünge über mehrere Oktaven hinweg; Verformungen und Verfremdungen, welche die Stimme zu einem Instrument machen, gegenüber dem so mancher Synthesizer blass aussieht.
Richtig utopisch (oder, je nach Blickwinkel, apokalyptisch) werden diese Visionen, wenn man sie noch in die Forschung nach einer komponierenden AI einbindet, welche bereits bemerkenswerte erste Erfolge feiert. So müssten gar keine menschlichen Produzenten als „humanoide Krücke“ den virtuellen Kreativen die Songs auf den virtuellen Leib schreiben. Vielmehr könnte diese Aufgabe von Algorithmen übernommen werden. Schon in den letzten Jahren ist der Input schöpferischer Software deutlich signifikanter geworden, wie beispielsweise bei dem (großartigen) aktuellen Album von Taryn Southern, auf dem sich die Schauspielerin und Musikerin eine Vielzahl Ideen für Sounds, Arrangements, Harmonien und Melodien von AI-Apps liefern ließ. Für alle, denen das noch nicht genug ist, gibt es noch Pacemaker, eine DJ-Software für iPhone und iOS, welche über ein bemerkenswert gutes Gefühl für Flow und nahtlose Übergänge besitzt. So können die Hologramme der Zukunft dann nach dem erfolgreichen Konzert auch gleich anschließend auf der Afterparty auflegen.
Vielleicht erscheinen irgendwann einmal menschliche Popstars als exotische Attraktion. Dann könnten künstliche Intelligenzen ihnen Pop-Songs auf den Leib schreiben, DJ-Mixe für sie erstellen und Video-Clips schießen. Nur auf Tour sollte man sie wohl nicht schicken – sie sind einfach nicht zuverlässig genug, diese Menschen.